 |
 |
 |
 |
Was die Bilder nicht
erzählen
Ronit Matalon: Was die
Bilder nicht erzählen, Reinbek: Rowohlt,
1998

von Micha Elm
 |
 |
 |
 |
 |
 |
  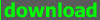 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

  "Ma nièce", erklärt er den
Einkäufern, die mir zunicken. Mit seinen über
sechzig Jahren – zehn Pleiten hinter sich,
begleitet von Touren durch ganz Afrika von einem maroden
Unternehmen zum anderen, erkrankt an allen Leiden, die
dieser Ort zu bieten hat, ohne Haare und Zähne, mit
einer Stimme wie Tino Rossi, die junge Mädchen
erbleichen läßt – trägt er jetzt
mehr denn je die typischen Familienzüge. Das
zähe Schicksal hat sich mit Gewalt durchgesetzt,
hat mit Gewalt das seine genommen, pfeift mit seinem
großen Maul auf den Staub der persönlichen
Wahl, zerreibt diese Wahl selbst zu Staub und offenbart
die verschlossenen Züge von Nona Fortunée,
Mutter und Onkel Moïse, die Sinnlichkeit der
Lippen, die sich mittels zweier tiefer, strenger Falten
zu beiden Seiten des Mundes tarnt, und die schmalen
Wangen mit den vornehm spitzen Knochen darüber, die
jede Verwandtschaft mit dem plumpen, verschlampten
Körper leugnen, den nachlässig irgendein Hemd
bedeckt.
"Ma nièce", erklärt er den
Einkäufern, die mir zunicken. Mit seinen über
sechzig Jahren – zehn Pleiten hinter sich,
begleitet von Touren durch ganz Afrika von einem maroden
Unternehmen zum anderen, erkrankt an allen Leiden, die
dieser Ort zu bieten hat, ohne Haare und Zähne, mit
einer Stimme wie Tino Rossi, die junge Mädchen
erbleichen läßt – trägt er jetzt
mehr denn je die typischen Familienzüge. Das
zähe Schicksal hat sich mit Gewalt durchgesetzt,
hat mit Gewalt das seine genommen, pfeift mit seinem
großen Maul auf den Staub der persönlichen
Wahl, zerreibt diese Wahl selbst zu Staub und offenbart
die verschlossenen Züge von Nona Fortunée,
Mutter und Onkel Moïse, die Sinnlichkeit der
Lippen, die sich mittels zweier tiefer, strenger Falten
zu beiden Seiten des Mundes tarnt, und die schmalen
Wangen mit den vornehm spitzen Knochen darüber, die
jede Verwandtschaft mit dem plumpen, verschlampten
Körper leugnen, den nachlässig irgendein Hemd
bedeckt.
Vierzig Jahre ist er wie ein Schlamper durch die Welt
vagabundiert, bis ihn die Alterssentimentalität
ereilte, dieses Gefühlsvibrato: Jemanden von der
Familie möchte er auf einmal sehen,
quelqu’un de la famille, der kommt und ein
bißchen in seinem Achtzimmerhaus bei ihm sitzt,
warum nicht?"
Und so kommt sie, la nièce, nicht ganz
freiwillig, wie sich herausstellt, wird sie auf die
Reise geschickt. Siebzehnjährig soll sie mit den
Realitäten der Welt vertraut gemacht werden, den
Kopf zurechtgerückt bekommen. Und wer wäre
dazu besser geeignet als Onkel Cicurel, mit seinem
Fischereibetrieb in Douala\Camerun, der die
geschäftlichen und privaten Verlogenheiten seiner
Mitmenschen gnadenlos durchschaut, sie auf ihre
Interessen- und Machtgeleitetheit reduziert und
darüber zynisch geworden ist."
So beginnt die autobiographisch gefärbte
Erzählung Ronit Matalons, die der Geschichte ihrer
Familie nachstöbert; einer Familie jüdischer
Herkunft im Kairo der dreißiger Jahre, die
ökonomisch verarmt, kulturell dem
Großbürgertum nahestehend, mit der 1952 von
Nasser initierten sozialistischen Machtübernahme
das Land verlassen muß. Zwei Kapitel des Romans
sind Essays einer anderen Autorin, Jacqueline Kahanoffs,
die Matalon dazu verwendet, die Stimmung des Kairos der
dreißiger Jahre zu beschreiben. In ihnen kommt die
Zerrissenheit der jungen Frauen der jüdischen,
griechischen, syrischen und koptischen Minderheiten zum
Ausdruck, deren Emanzipation mit ihrer gehobenen Bildung
enden soll. Die Frauen sehen sich in einer
Vermittlerinnenrolle zwischen europäischen
Befreiungsideen und arabisch-moslemischer Gesellschaft.
Matalon rekonstruiert zum einen die verschüttete
Geschichte und greift mit ihrer Hauptperson Esther, den
naiv aufklärerisch und emanzipativen Geist dieser
Epoche in Zeiten des Postkolonialismus wieder auf.
 Die Geschichte wird entlang gewöhnlicher
Familienfotos erzählt, die auf den ersten Blick so
langweilig aussehen, wie Familienfotos eben sind; Eltern
mit Kindern im Arm, das Brautpaar am Hochzeitstag,
verschiedene Menschen die etwas bemüht in die
Kamera lächeln. Erstaunlicherweise gelingt es der
Erzählerin durch die detailgetreue Schilderung der
Bilder, sie ihrer Trivialität zu enteignen, bis zu
einem Punkt, an dem man auf die Gewohnheiten und
Nachlässigkeiten des eigenen Blicks
stößt. Freilich kommt da noch die fehlende
Geschichte um die Bilder hinzu, die so manchen Blick
erst ermöglicht und das Banale in etwas Besonderes
oder gar Vertrautes verwandelt.
Die Geschichte wird entlang gewöhnlicher
Familienfotos erzählt, die auf den ersten Blick so
langweilig aussehen, wie Familienfotos eben sind; Eltern
mit Kindern im Arm, das Brautpaar am Hochzeitstag,
verschiedene Menschen die etwas bemüht in die
Kamera lächeln. Erstaunlicherweise gelingt es der
Erzählerin durch die detailgetreue Schilderung der
Bilder, sie ihrer Trivialität zu enteignen, bis zu
einem Punkt, an dem man auf die Gewohnheiten und
Nachlässigkeiten des eigenen Blicks
stößt. Freilich kommt da noch die fehlende
Geschichte um die Bilder hinzu, die so manchen Blick
erst ermöglicht und das Banale in etwas Besonderes
oder gar Vertrautes verwandelt.
Die Autorin, Ronit Matalon, Journalistin und Dozentin
an einer Kunsthochschule in Tel Aviv, schildert die
Familiengeschichte in doppelter Distanziertheit zu ihrer
eigenen Person; nicht nur wählt sie die fiktive
Erzählerin Esther, sondern diese redet über
sich zumeist auch noch in der dritten Person. Nur selten
gelingt es Esther über sich in der ersten Person zu
reden. Einmal geschieht es genau in dem Augenblick, in
dem sie begreift, wie sehr sie sich gegenüber
anderen verstellt, ihnen nicht ihre tatsächlichen
Gedanken mitteilt, die ganz normalen Unausgesprochen-
und Verlogenheiten also. Gleichzeitig merkt sie, wie sie
sich dabei selbst hintergeht, indem Sie Beziehungen
pflegt, die ihr im Grunde nicht viel bedeuten. Es
scheint, als wäre es gerade die Einsicht in die
Aufgespaltenheit ihrer Person zwischen öffentlichen
und privaten Ansichten, die Sie befähigen,
`Ich´ zu sagen. Sie begibt sich damit einer naiven
Aufgeklärtheit und Kindlichkeit der
17-jährigen Erzählerin, allerdings mit der
Absicht die Zwiespältigkeit aufzuheben, nicht sich
resigniert auf sie zurück zu ziehen.
 Mit dem Stolz aufgeklärter Töchter
rebelliert sie gegen den Rassismus ihrer Gastfamilie,
will sie die schwarzen Hausangestellten des Onkels als
frei und gleich behandeln und ist dabei meilenweit von
deren Realität entfernt. Der eigene postkoloniale
Rassismus holt sie dann auch bei einem Besuch im
Elendsquartier des Kochs Julien jäh ein, dem sie
zur vermeintlichen Geburt seines ersten Kindes einen
großen Teddybären schenken will. So richtig
gut kommt keiner weg im familiären Gruselkabinett.
Mutter und Herumtreiber Vater, Großvater Jacqout
und Nona Fortunée, die beide auf ihre Weise in
der Vergangenheit hängengeblieben sind, Bruder
Edouard, der Araberhasser, am ehesten noch Onkel
Moïse, der den größten Teil der Familie
nach Israel bringt, aber auch seine Anstrengung die
Familie zusammenzuhalten, wirkt irgendwann zwanghaft.
Mit dem Stolz aufgeklärter Töchter
rebelliert sie gegen den Rassismus ihrer Gastfamilie,
will sie die schwarzen Hausangestellten des Onkels als
frei und gleich behandeln und ist dabei meilenweit von
deren Realität entfernt. Der eigene postkoloniale
Rassismus holt sie dann auch bei einem Besuch im
Elendsquartier des Kochs Julien jäh ein, dem sie
zur vermeintlichen Geburt seines ersten Kindes einen
großen Teddybären schenken will. So richtig
gut kommt keiner weg im familiären Gruselkabinett.
Mutter und Herumtreiber Vater, Großvater Jacqout
und Nona Fortunée, die beide auf ihre Weise in
der Vergangenheit hängengeblieben sind, Bruder
Edouard, der Araberhasser, am ehesten noch Onkel
Moïse, der den größten Teil der Familie
nach Israel bringt, aber auch seine Anstrengung die
Familie zusammenzuhalten, wirkt irgendwann zwanghaft.
Der analytische Blick, der nötig ist, um in
dieser Offenheit über die nächsten
Angehörigen sprechen zu können, bleibt seltsam
gefühlvoll,– und das meint nicht das Gerede
über die kleinen Schwächen der Leute, die sie
so menschlich machen –, gerade das Glättende
einer solchen Betrachtung versagt sie sich die Autorin.
Sicher verschafft die eindringliche Beschäftigung
mit den nächsten Angehörigen einen anderen
Zugang und führt zu einem gewissen Verständnis
noch deren Macken, aber es kommt etwas anderes hinzu:
Die Stimme, die hier erzählt, scheint einen Ausweg
aus dem Dickicht von Betrug und Selbstbetrug gefunden zu
haben. Sie enthält sich eines abschließenden
Urteils und mutet es der/m LeserIn selber zu, einen
Standpunkt zu beziehen. Indem das biographische Wissen
um sich und die anderen zwar zur Selbständigkeit
beiträgt, aber an der Eigenständigkeit der
anderen seine Grenze hat, entsteht nicht der Eindruck,
daß einem hier was aufgenötigt werden soll.
Vermieden wird ein klassischer Irrtum von
Aufklärung, daß diese von sich aus
irgendwohin führe. In der Erzählung existiert
eine Zuversicht auf Gegenseitigkeit, die sich
höchstens im fiktiven Dialog mit der/m LeserIn,
kaum aber im Roman selber ereignet, ihr aber die
besondere Stimmung verleiht.
 Gegen Ende des Romans taucht eine entfernte Verwandte
auf, die die Antithese zu dieser Haltung
verkörpert, vielleicht ein weiteres alter ego der
Autorin. Susa ist Redakteurin bei der Washington
Post und will ein Buch über die absonderliche
Geschichte dieser jüdischen Familie in Ägypten
schreiben. Die Fernsehserie "Roots" ist gerade
das Thema in den USA. Dazu findet ein Treffen mit Mutter
und Esther im Hilton-Hotel in Tel Aviv statt, bei dem
Susa Details und Curiositäten aus dem Kairoer Leben
der Familie erfahren will. Aber jede noch so nette
Begebenheit, wie die endlosen Lieferungen von mit
Käse, Kartoffeln, Spinat, mit kaltem Joghurt
gefüllten Teigtaschen die die Kinder verschlingen,
gerinnt unter diesem Blick.
Gegen Ende des Romans taucht eine entfernte Verwandte
auf, die die Antithese zu dieser Haltung
verkörpert, vielleicht ein weiteres alter ego der
Autorin. Susa ist Redakteurin bei der Washington
Post und will ein Buch über die absonderliche
Geschichte dieser jüdischen Familie in Ägypten
schreiben. Die Fernsehserie "Roots" ist gerade
das Thema in den USA. Dazu findet ein Treffen mit Mutter
und Esther im Hilton-Hotel in Tel Aviv statt, bei dem
Susa Details und Curiositäten aus dem Kairoer Leben
der Familie erfahren will. Aber jede noch so nette
Begebenheit, wie die endlosen Lieferungen von mit
Käse, Kartoffeln, Spinat, mit kaltem Joghurt
gefüllten Teigtaschen die die Kinder verschlingen,
gerinnt unter diesem Blick.
Während sich die einen mehr schlecht als recht
durchs Leben schlagen, kommt die Aufklärung in
Gestalt eines investigativen Journalismus daher und will
die Misere der Unwissenden offenkundig machen.
Hübscher läßt sich Verdinglichung kaum
darstellen. |
 |
 |
 |
 |
 |
  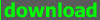 |
 |
 |
 |
 |
|