
C
Gerechtigkeit und soziale Grundsicherung
Es ist klar geworden, daß eine Reihe von Reformvorschlägen vorliegen, welche die aktuelle Lage in bezug auf die soziale Grundsicherung in der Bundesrepublik für alle verbessern können. Je nach Reichweite bedeuten sie einen unterschiedlichen finanziellen und organisatorischen Aufwand und haben unterschiedlich stark mit der gesellschaftlichen Akzeptanz zu kämpfen.
Es gibt einige Unausgewogenheiten im gegenwärtigen System, die, sobald sie beseitigt würden, ohne höheren Kostenaufwand die Aufgaben erleichterten und den HilfebezieherInnen ein höheren Lebensstandard garantierten.
Wie gezeigt wurde, gibt es auch eine Reihe von Argumenten, die dafür sprechen, am status quo grundsätzlich etwas zu ändern. Die unterschiedlichen Konzepte haben — neben der Finanzierung — das Problem, daß sie sich nicht allein auf den status quo stützen können, sondern, da sie mitunter starke Reformen erfordern, aufwendigere Begründungsstrategien entwickeln müssen.
Nicht nur ist die bisherige Begründung von sozialer Grundsicherung generell mangelhaft, es ist bisher auch undeutlich, wie eine progressive Reform mit anderer, i.d.R. stärkerer Umverteilung zugunsten der schlecht Gestellten, gegenüber einer reaktionären Orientierung überhaupt durchzusetzen ist. Da es an rein innerökonomische Überlegungen zugunsten einer Grundsicherung eher mangelt, liegt es auf der Hand, auch andere als rein ökonomische Argumente heranzuziehen.
Wenn es überzeugende Argumente für eine staatliche Umverteilung, also für ein Eingreifen in den freien Marktmechanismus, gibt, so könnte dadurch auch eine soziale Grundsicherung begründet werden, obwohl diese bezogen auf die ökonomische Zweckmäßigkeit nicht optimal sein muß. Es könnte auch die Form der Grundsicherung bestimmt werden, und welchen Stellenwert sie für bestimmte Gesellschaftsformen haben kann, das heißt auch, welcher finanzielle Umfang mit ihr verbunden sein sollte.
Im Teil B wurde ausgeführt, daß für eine umfangreiche Rechtfertigung von sozialer Grundsicherung Argumente herangezogen werden müßten, die sich daran orientieren, welche Form der Veränderung der bestehenden Situation für die Betroffenen Vorteile hätte. Letztlich kann auch eine rein ökonomische Argumentation nur so funktionieren, denn die Beseitigung von Mängeln, etwa eines Marktsystems, macht auch nur dann Sinn, wenn die Auswirkungen von den Betroffenen akzeptiert werden können.
Es wird unterstellt, daß es eine Reihe von Situationen gibt, in denen der freie Markt nicht optimal funktioniert, um den TeilnehmerInnen ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Es wird weiterhin unterstellt, daß neben den Kosumbedürfnissen u.a. Sicherheitsbedürfnisse und Grundrechtsverständnisse bestehen, die ein Leben nach einem nicht zu niedrigen Standard fordern. Daraus folgt, daß Eingriffe in den Markt in Form von Umverteilungen, die diese Bedürfnisse besser befriedigen, gerechtfertigt sein können.
Eine genauere Bestimmung des "besser als vorher" bleibt vorerst unbestimmt. Es gibt allerdings eine Reihe von Theorien, die zu begründen versuchen, welcher Zustand derjenige ist, der gegenüber anderen Zuständen "gerecht" ist. Bei einer Verbesserung des bisherigen Zustandes müßte darauf geachtet werden, wer von der Veränderung profitiert, und ob (v.a. wenn nicht alle gleichermaßen profitieren) diese Veränderung gerechtfertigt ist. Es könnte also auch passieren, daß die überzeugendste Gerechtigkeitstheorie in bezug auf Güterverteilungsfragen gerade den status quo rechtfertigt, oder einen Zustand, der die HilfeempfängerInnen noch schlechter stellt als bisher.
Im Laufe dieses Teils wäre demnach folgendes zu klären
Dazu sollen zunächst einige Gerechtigkeitstheorien vorgestellt werden, die sich mit Formen gerechter Güterverteilung beschäftigen. Obwohl es nicht gelingen kann, hier alle Überlegungen mit einzubeziehen, sollen doch neuere Ansätze aus dem libertären, dem liberalen, dem utilitaristischen, dem marxistischen und dem kommunitaristischen Spektrum mehr oder weniger berücksichtigt werden.
Eine der erste Grundfrage lautet, warum qualitative Gleichheit als Ideal für Gerechtigkeit besonders interessant ist, denn mit der Begründung von Gleichheit ist zugleich ein Grundstein gelegt für Umverteilung zugunsten einer Angleichung der Ressourcen, da dies ein Aspekt der Gleichheit sein kann. Die Theorien, die Gleichheit nicht als erstrebenswert für Gerechtigkeit ansehen, werden einer Umverteilung nicht im gleichen Maße wie die egalitären Theorien zustimmen. Eine weitere Frage lautet, in welchem Verhältnis Freiheit und Gleichheit stehen, ob sie einander bedingen, oder ob ein mehr an Gleichheit ein weniger an Freiheit mit sich bringt.
Nach dem Versuch eine soziale Grundsicherung zu begründen, die Art und Weise und das Ausmaß, soll eine erneute Beurteilung der bestehenden Modelle vorgenommen werden. Dazu ist es nötig, die Kriterienkataloge von Kaltenborn und Hauser neu zu ordnen und zu bewerten. Danach kann ein Vorschlag für ein oder mehrere brauchbare und gut begründbare Modelle folgen.
1. Gerechtigkeitstheorien
Es liegt eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze vor, die eine gerechte Organisation menschlichen Zusammenlebens zu begründen versuchen. Nur ein Teil davon beschäftigt sich mit der gerechten Güterverteilung. Da hier auf die Begründung einer Umverteilung zugunsten sozialer Grundsicherung gezielt wird, kann nicht auf alle Ansätze (insbesondere die nichtegalitären - u.a. Margalit, Walzer, Nussbaum, Frankfurt) eingegangen werden.
Die Darstellung wird sich auf die Überzeugungskraft der Theorien von Rawls, Dworkin, Sen, Cohen, van Parijs, Roemer und Arneson beschränken, die allesamt genug Material für eine egalitär orientierte Begründung der sozialen Grundsicherung bieten.
1.1 Rawls
Obwohl John Rawls' Theorie oft (wie auch im Folgenden zu sehen) als eine Variante eines verbesserten Utilitarismus gedeutet wird, ist sie doch mehr als das. Sein Hauptwerk bezüglich der Gesamtkonzeption hat 1971 einen Wendepunkt in der Politischen Philosophie bedeutet, da die Kritik am bis dahin beherrschenden Utilitarismus erstmals in einer systematischen Alternative geäußert wurde. Alle nachfolgenden Gerechtigkeitstheorien beziehen sich mehr oder weniger auf Rawls' Auseinandersetzung mit dem Utilitarismus und seinen Lösungsvorschlag, der als "Gerechtigkeit als Fairneß" formuliert wird.
Der problematischen Vereinfachung des Utilitarismus, der keine klaren Grenzen des Opferns zugunsten der Nutzenmaximierung in unterschiedlichen Varianten bot, mußte eine konstruktive, strenge Begründung von Grundrechten entgegengestellt werden. Rawls formuliert sein an die Gleichverteilung angelehntes Gerechtigkeitsideal deshalb so, daß alle Grundgüter (seien sie materieller oder immaterieller Art) gleich zu verteilen seien, es sei denn, eine (begrenzte) Ungleichverteilung kommt den am wenigsten Begünstigten zugute. Dieser Vergleich findet nicht nur in bezug auf die aktuelle Situation der sogenannten "worst-off" statt, sondern auch im bezug auf die Grundausstattung, die sie hätten, wenn alle Grundgüter gleich verteilt und alle weiteren Güter gerecht verteilt wären.
Nun gibt es aber unterschiedliche materielle und immaterielle Güter, die unabhängig voneinander verteilt werden können. Wie wird also die Gesamtsumme der Qualität der momentanen Situation festgestellt? Kann es nicht passieren, daß einige Güter gerechter zuungunsten anderer verteilt werden? Aus diesem Grund hat Rawls ein Vorrangsystem installiert, daß die Wertigkeit unterschiedlicher Grundgüter sicherstellt.
Es gibt zwei Grundsätze, die in einer lexikalischen Reihenfolge angeordnet sind. Das heißt, der zweite Grundsatz ist nur sobald und so lange von Bedeutung, wie der erste erfüllt ist.
"Erster Grundsatz
Jedermann hat gleiches Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten, das für alle möglich ist.
Zweiter Grundsatz
Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen folgendermaßen beschaffen sein:
(a) sie müssen unter der Einschränkung des gerechten Spargrundsatzes den am wenigsten begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen, und
(b) sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen gemäß fairer Chancengleichheit offenstehen.
Erste Vorrangregel (Vorrang der Freiheit)
Die Gerechtigkeitsgrundsätze stehen in lexikalischer Ordnung demgemäß können die Grundfreiheiten nur um der Freiheit willen eingeschränkt werden, und zwar in folgenden Fällen:
(a) eine weniger umfangreiche Freiheit muß das Gesamtsystem der Freiheiten für alle stärken;
(b) eine geringere als gleiche Freiheit muß für die davon Betroffenen annehmbar sein.
Zweite Vorrangregel (Vorrang der Gerechtigkeit vor Leistungsfähigkeit und Lebensstandard)
Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz ist dem Grundsatz der Leistungsfähigkeit und Nutzenmaximierung lexikalisch vorgeordnet; die faire Chancengleichheit ist dem Unterschiedsprinzip vorgeordnet, und zwar in folgenden Fällen:
(a) eine Chancen-Ungleichheit muß die Chancen der Benachteiligten verbessern;
(b) eine besonders hohe Sparrate muß insgesamt die Last der von ihr Betroffenen mildern."
Obwohl die Güterverteilung nach dem Differenzprinzip bei Rawls nachgeordnet ist, spielt sie im hiesigen Zusammenhang die ausschlaggebende Rolle. Im weiteren Verlauf wird deshalb besonders darauf verwiesen, wie auch insgesamt versucht wird, die Argumentation, die zu den Grundsätzen führt, nachzuvollziehen.
Kritik der vereinfachten Chancengleichheit
Ein Grundgedanke gerecht organisierten gesellschaftlichen Zusammenlebens ist, zumindest in Demokratien mit marktwirtschaftlicher Organisation, das Ideal der Chancengleichheit. Güter und Positionen sollen allen Menschen offenstehen. Da sie begrenzt sind, sollen sie über einen fairen Wettbewerb zugewiesen werden. Dieser Wettbewerb soll ermöglichen, daß genau diejenigen Personen bestimmte Güter und Positionen erhalten, die für sie am besten geeignet sind und die sie sich unter Leistung erarbeiten. So könnte eine unumgehbare Ungleichheit gerechtfertigt werden, ohne daß sie als ungerecht erscheint. Denn genau diejenigen Personen erhalten mehr von begrenzten Ressourcen, die sie am besten nutzen (was auch der Allgemeinheit zugute kommen kann) und die sie am meisten begehren.
Diese einfache Überlegung beinhaltet aber mindestens drei Probleme:
Selbst wenn das Leistungsprinzip akzeptabel erscheint, und davon ausgegangen wird, daß Entscheidungsinkonsistenzen alle gleichermaßen treffen, ist doch die Idee der Chancengleichheit dann nicht verwirklicht, wenn die Ausgangssituationen ungerechterweise ungleich sind. Die kritisierte Variante der Chancengleichheit nennt Rawls deshalb auch "formale Chancengleichheit".
Eine gewisse Angleichung von Unterschieden scheint also zu begrüßen zu sein. Da die Menschen aber nicht gleich zu machen sind, und auch nicht für alle Ungleichheiten geeignete Entschädigungsformen zu finden sind, schlägt Rawls vor, daß Ungleichheiten solange bestehen dürfen, wie sie für die am stärksten Benachteiligten noch von Vorteil sind. Das erscheint sinnvoll, v.a. weil eine Angleichung der Unterschiede nicht unbedingt sein muß, wenn andererseits der Gewinn durch eine Ungleichverteilung auch für alle Vorteile hätte. Anhand von Wohlfahrtsfunktionen veranschaulicht hieße dies, eine Liste von Indexgütern zusammenzustellen, die in einer Funktion aggregiert und anhand eines Diagramms verdeutlicht werden können. Rawls würde sich an der Pareto-Optimalität (also das Optimum für alle) und am Optimum für die repräsentative Gruppe der "worst-off" orientieren (etwa den untersten 2% der relevanten Gemeinschaft). Ab dem Punkt, wo der Zugewinn für die "worst-off" sich von anderen Optimumkriterien (z.B. von der Produktivität) ablöst, wird die Umverteilung gestoppt. Somit würde nach Rawls beispielsweise der höchste Mindestlohn weder dort erzielt, wo alle Arbeitenden gleich entlohnt würden, noch dort, wo Leistung besonders stark belohnt wird (was zu einer besonders hohen Produktivität führen würde).

Vielleicht läßt sich dieses Differenzprinzip auch als eine bloß verbesserte Idee des Utilitarismus formulieren. Auf jeden Fall funktioniert sie aber so, daß wenn Person P1 gegenüber dem status quo von einer Gleichverteilung den Nutzen -1 hätte und P2 den Nutzen +1 (oder gar nur 0), P1 aber von einer alternativen Ungleichverteilung den Nutzen +2 und P2 den Nutzen +1,5, die Ungleichverteilung vorzuziehen ist, wenn (und das ist auf jeden Fall der nichtutilitaristische Aspekt) die lexikalische Rangordnung der o.g. Grundsätze nicht verletzt wird.; Unklar bleibt, wann genau durch die rechtmäßige Anwendung des zweiten Grundsatzes der erste verletzt werden kann. Wenn durch Abtreten von Eigentum zugunsten anderer bereits das Freiheitsrecht der Selbstbestimmung verletzt wird, greift der libertäre Ausbeutungsvorwurf, der später noch behandelt werden soll.
Die vernünftige Entscheidung im hypothetischen Urzustand
Rawls wichtigster Brückenschlag zur argumentativen Untermauerung seiner Gerechtigkeitsvorstellung läuft aber nicht über die intuitiv unplausible Vorstellung eines unkritischen Chancengleichheitsideals, sondern über das Konstruieren eines Zustandes, in dem wir die richtigen moralischen Entscheidungen im Bezug auf Grundsatzfragen treffen würden.
Diese Situation beschreibt Rawls als einen "Urzustand", der u.a. dadurch gekennzeichnet ist, daß wir uns darin hinter einem "Schleier des Nichtwissens" befinden. Um gerechte Verhältnisse zu schaffen, ist es angebracht, der (liberalen) Grundidee der moralischen Gleichheit der Menschen einen angemessenen Stellenwert einzuräumen. Der Urzustand soll eben das gewährleisten, da er die Situation darstellt, in der die Gleichheit von moralischen Subjekten herrscht. Wir könnten uns jeder Zeit in die abstrakte Lage des Urzustandes befördern, denn es handelt sich nicht um eine zeitlich gebundene Einstiegssituation, sondern im Prinzip um eine Situation, in der wir nur als gleiche Menschen mit den Eigenschaften, die Menschen nun mal notwendigerweise haben, befinden. Eigentlich ist es ein Zustand, in dem wir uns als reine Vernunftwesen befinden, getrennt von unseren sekundären Eigenschaften, die uns bloß zufallen, seien sie auch für uns als Individuen in der wirklichen Welt noch so signifikant.
"Zu den wesentlichen Eigenschaften dieser Situation gehört, daß niemand seine Stellung in der Gesellschaft kennt, seine Klasse oder seinen Status, ebensowenig sein Los bei der Verteilung natürlicher Gaben wie Intelligenz oder Körperkraft. Ich nehme sogar an, daß die Beteiligten ihre Vorstellung vom Guten und ihre besonderen psychologischen Neigungen nicht kennen. Die Grundsätze der Gerechtigkeit werden hinter einem Schleier des Nichtwissens festgelegt. Diese gewährleistet, daß dabei niemand durch die Zufälligkeiten der Natur oder der gesellschaftlichen Umstände bevorzugt oder benachteiligt wird."
Die Frage bleibt nur, ob in dieser Situation überhaupt noch menschliche Individuen sie selbst betreffende Entscheidungen treffen, da offen ist, was in diesem Zustand eine persönliche Identität ausmachen kann.
"Doch der Schleier des Nichtwissens drückt keine Theorie der persönlichen Identität aus. Er ist ein intuitiver Fairneßtest, ähnlich wie man eine faire Aufteilung eines Kuchens dadurch zu erreichen sucht, daß man dafür sorgt, daß die Person, die die Stücke schneidet, nicht weiß, welches sie bekommen wird."
Ungeklärt ist auch noch, warum die moralischen Subjekte gerade das Differenzprinzip hinter dem Schleier des Nichtwissens wählen würden, da kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Rawls' Gerechtigkeitsvorstellung und der Situation der moralisch richtigen Entscheidung besteht.
Rawls geht von einer Reihe von Voraussetzungen aus, um zur vernünftigen Wahl des Differenzprinzips zu gelangen, die sich der Kritik stellen müssen. Er unterstellt zunächst, daß wir alle, wenn wir auch sehr unterschiedliche Ziele haben können, ein Ideal eines guten Lebens haben und, daß wir versuchen, alles daran zu setzen, eine sinnvolle Konzeption dieses Ideals zu erarbeiten. Um dies zu erreichen, versuchen wir, mindestens all diejenigen Güter für uns zu sichern, die uns ein lebenswertes Leben nach unserem Ideal ermöglichen. Diese Güter bezeichnet er als Grundgüter. Diese gesellschaftlichen Grundgüter (weitere relevante Grundgüter sind natürlicher Art) wollen wir so verteilt wissen, daß für uns das geringste Risiko besteht, sie nicht zu erlangen. Er geht somit von einer Risikoaversion aus. Da niemand weiß, welche Position ihm oder ihr in der wirklichen Welt zufallen wird, muß er/sie im Grunde für alle und aus allen heraus entscheiden. Dies scheint unmöglich zu sein. Wenn aber davon ausgegangen wird (und das tut Rawls), daß wir bloß als moralische Subjekte die Entscheidung treffen, würde nur eine getroffen, solange sie vernünftig ist, weil sie "die beste verfügbare Möglichkeit ist, seine Ziele zu fördern."
Wenn wir etwas auf jeden Fall mindestens erreichen wollen und ‚auf Nummer sicher gehen‘, gibt es nach Rawls nur eine vernünftige Entscheidung bezüglich der Verteilung der gesellschaftlichen Grundgüter:
"Nach Rawls ist es eine ‘Maximin’-Strategie: man rechnet jeweils mit dem Schlechtesten (dem Minimum) und sorgt dafür, daß dieses möglichst günstig (maximal) ist. Nach Rawls entspricht es dem, daß man seine schlimmsten Feinde entscheiden läßt, welchen Platz man in der Gesellschaft einnehmen wird. Daher wählt man die Ordnung, in der der ungünstigste eigene Anteil am günstigsten ist."
Zwar ist diese Maximin-Strategie nachvollziehbar, doch sind die impliziten psychologischen Annahmen einerseits für Entscheidungen rein vernünftiger Art gefährlich, andererseits nicht stark genug belegt. Hinzu kommt, daß vielerorts kritisiert wird, der Schleier des Nichtwissens sei von vornherein zu stark auf das zu erreichende Ergebnis (das Differenzprinzip) zugespitzt. Es könnte also sein, daß die Vertragssituation uns nur hilft, unsere Intuitionen zu präzisieren und brauchbare Folgerungen aus ihnen zu ziehen, während unklar bleibt, ob es nur ein vernünftiges Ergebnis eines Vertrages geben kann. Wie stark das Argument von der vernünftigen Entscheidung im Urzustand gegenüber dem intuitiven Argument letztlich ist, bleibt deshalb umstritten.
Rawls hingegen behauptet, ein Überlegungsgleichgewicht zu schaffen, daß u.a. den Aspekt der vernünftigen Entscheidung in einer Urzustandssituation beinhaltet. Auf der anderen Seite gibt es die Betrachtung zahlreicher Alltagssituationen, die unsere intuitiven Gerechtigkeitsvorstellungen zur Geltung bringen sollen. Wenn allerdings die Herstellung eines Gleichgewicht als rationale Handlung wieder nur als Abwägen verstanden wird, gerät die Theorie selbst schnell in gefährliche Nähe zum zuvor kritisierten Intuitionismus. Zudem hat die Idee des Überlegungsgleichgewichts die Tendenz zum Konservatismus oder Reformstau, da sie von klaren und "gesettleten" Überzeugungen ausgeht und außerdem den Konsens mit allen Mitgliedern der Gemeinschaft anstrebt.
Zusätzliche Probleme ergeben sich bei der Umsetzung der Gerechtigkeitsprinzipien. So gibt es eine Reihe von Fällen, bei denen das Rawlssche Differenzprinzip ungeeignet zu sein scheint oder sogar der zugrunde liegenden Gerechtigkeitsintuition selbst widerspricht. Der Ausgleich für natürliche Ungleichheiten über die nach dem Differenzprinzip verteilten gesellschaftlichen Güter funktioniert oft nur unbefriedigend. Die Korrektur der Inkonsistenz im vereinfachten Chancengleichheitsprinzip bleibt bei Rawls in bezug auf das individuelle Wohlergehen deshalb blind, weil es keinen wirklichen Ausgleich für natürliche Benachteiligung schafft. Es ist nicht klar, ob der Vorteil der "worst-off" groß genug ist, um individuelle natürliche Benachteiligung auszugleichen.
"Das Unterschiedsprinzip sorgt dafür, daß die Begabten nicht mehr und die Behinderten nicht weniger gesellschaftliche Güter bekommen. Aber damit werden ‘die Wirkungen natürlicher und gesellschaftlicher Zufälligkeiten’ nicht völlig ‘abgemildert’."
"Und wenn jemand bei den gesellschaftlichen Gütern nur geringfügig bevorzugt ist, dann ist er für Rawls besser gestellt, auch wenn sein Einkommensvorteil nicht ausreicht, um die Mehrkosten wegen natürlicher Benachteiligungen zu bestreiten, etwa Arztkosten oder Sonderausstattungen wegen einer Behinderung."
Auch Pogge erkennt dieses Problem, stellt Rawls' Lösung allerdings insgesamt als befriedigend dar, da die prinzipielle Auslassung aller natürlichen Faktoren (positiv oder negativ) einen Kompromiß darstellt.
"Man könnte für diese Auslassung eine prinzipielle Begründung geben: Die Verteilung natürlicher Güter wird nicht durch Institutionen geregelt oder beeinflußt. [...] Man kann natürlich nicht sagen, daß Menschen ihre natürliche Ausstattung verdient haben oder sonstwie dafür verantwortlich sind - aber doch, daß die Gesellschaft dafür ebenfalls nicht verantwortlich zu machen ist: Eine Gesellschaft braucht im Hinblick auf natürliche Ungleichheiten keine Funktion ausgleichender Gerechtigkeit zu übernehmen. [...]
Eine solche prinzipielle Begründung, die Rawls selbst nicht vorträgt, erscheint mir im Wesentlichen plausibel. Sie nimmt eine vernünftige Mittelstellung zwischen zwei Extremen ein. Ein Extrem ist die Tendenz, auf natürliche Ungleichheiten kompensatorisch zu reagieren, soziale Güter also in erster Linie den von der Natur am schlechtest gestellten zukommen lassen zu wollen. Das andere Extrem ist die, etwa im Utilitarismus vertretene Tendenz, soziale Güter in erster Linie denen zukommen lassen zu wollen, die, dank ihrer natürlichen Ausstattung, den größten Nutzen aus ihnen ziehen können.[...] Rawls' Gerechtigkeitskriterium steht zwischen diesen beiden Extremen [...]."
Trotzdem ist auch er der Ansicht, daß Rawls berücksichtigen müßte, wie die verteilten Grundgüter genutzt werden können; das hängt auch von der natürlichen Ausstattung der betroffenen Personen ab.
"Also muß ich diejenige Grundordnung anstreben, die die beste minimale Gesamtausstattung hervorbringen würde, also auch ein Gerechtigkeitskriterium wählen, das eine entsprechend erweiterte Grundgüterliste als Maßstab zugrundelegt."
Weiterhin wird das Prinzip der Gleichbehandlung verletzt, wenn die Menschen die Kosten ihrer Entscheidungen nicht mehr selbst tragen müssen, da das Differenzprinzip über die damit verbundenen Umverteilungsmaßnahmen die Auswirkungen rationaler Entscheidungen abdämpft und dafür andere Personen heranzieht.
Es deutet also einiges daraufhin, daß es von Vorteil wäre, ein Verteilungsprinzip hinzuzuziehen, das ausstattungs-insensitiv aber absichts-sensitiv ist und dabei unverdiente natürliche Benachteiligungen individuell zielgenauer ausgleicht (wie es z.B. Dworkin vorsieht). Allerdings ist auch eine solche Überlegung mit erheblichen Umsetzungsproblemen behaftet, da es um institutionelle Aufgaben geht, bei denen die Feinabstimmung einen hohen Aufwand erfordert. Zusätzlich könnte eine absichts- und bedürfnis-sensitive Regelung die von Rawls festgelegte Anonymitätsbedingung verletzen.
Bezogen auf eine soziale Grundsicherung läßt sich festhalten, daß die durch das Differenzprinzip gesicherten Grundgüter eine garantierte Lebensqualität für alle darstellen, die ein jeder befürworten würde. Somit ließe sich, trotz vieler Einwände, mit Rawls eine Grundsicherung rechtfertigen. Nach Rawls gewährt die wohlgeordnete Gesellschaft ihren Mitgliedern
"ein Existenzminimum entweder in Form von Familienbeihilfen und besonderen Zahlungen bei Krankheit und Arbeitslosigkeit oder systematischer etwa durch abgestufte Zuschüsse zum Einkommen (einer sogenannten negativen Einkommensteuer)."
Neben den Konkurrenzmärkten, die die freie Berufswahl und den optimalen Einsatz der Mittel gewährleisteten, müßte eine Umverteilungsabteilung installiert werden, die auf die Bedürfnisse eingeht und für eine gewisse Wohlfahrt sorgt. Rawls sieht ferner nicht vor, Einkommen durch Mindestlöhne zu beeinflussen, sondern eine proportionale (jährliche) Verbrauchsteuer einzuführen, da sie die (von der Gemeinschaft produzierten) Güter und deren Inanspruchnahme berücksichtige und nicht individuelle Leistung abschöpfe. Somit gehört Rawls, zumindest nach der TG, zu den Vertretern einer NIT unter Beachtung der Sicherung eines angemessenen sozio-ökonomischen Existenzminimums. Dafür braucht es scheinbar unbedingt den - zuvor bereits kritisierten - starken Konsens. An einer Stelle schreibt Rawls:
"Der Staat ist ebensowenig berechtigt, einige Bürger zu zwingen, für Dinge Steuern zu zahlen, die nur anderen Vorteil bringen, wie er sie zwingen kann, für die privaten Ausgaben anderer aufzukommen."
Die Höhe des Existenzminimums ist also durch die Konsensfähigkeit und den wirtschaftlichen Entwicklungsstand begrenzt. Zusätzlich muß noch der gerechte Spargrundsatz berücksichtigt werden, der sicherstellt, daß die Höhe des Existenzminimums heute nicht auf Kosten der zukünftigen Generationen finanziert wird.
"Wenn alle Generationen (außer vielleicht den früheren) Gewinn haben sollen, müssen sich die Beteiligten offenbar auf einen Spargrundsatz einigen, der dafür sorgt, daß jede Generation ihren gerechten Teil von ihren Vorfahren empfängt und ihrerseits die gerechten Ansprüche ihrer Nachfahren erfüllt."
1.2 Dworkin
Ronald Dworkin legt bei seiner Gerechtigkeitstheorie großes Gewicht auf die Verteilung frei verfügbarer Ressourcen. Er geht von einer weitgehenden Gleichverteilung aus, so daß sich spätere Ungleichverteilungen nur durch individuelle Entscheidungen bezüglich des Lebensstils ergeben können.
Diese Formulierung des Liberalismus als Liberalismus der Gleichheit hält er der libertären Formulierung des Liberalismus entgegen, die es dem Staat verwehrt, in moralischen Fragen in gemeinschaftliche Zustände und Prozesse einzugreifen. Damit stellt er sich mit seiner Interpretation des liberalen Prinzips zwar auf die Seite Rawlsens, möchte die Idee der Gleichheit als modifizierte Chancengleichheit aber radikaler umsetzen.
"It [liberalism based on equality] insists on an economic system in wich no citizen has less than an equal share of the community’s resources just in order that others may have more of what he lacks. [...] A government bent on the latter ideal must constantly redistribute wealth, eliminating whatever inequalities in wealth are produced by market transactions."
Am Utilitarismus kritisiert er u.a. die für eine demokratisch organisierte Gemeinschaft nicht akzeptablen Grundsätze, die der Unabhängigkeit des Individuums keinen Raum lassen.
Am rechtsliberalen Kurs kritisiert er (wie auch Rawls) die abstrakte Chancengleichheeitsvorstellung, die eben unter realistischen Bedingungen zu Chancenungleichheiten führt.
"This is the defect of the ideal fraudulently called ‘equality of opportunity’: fraudulently because in a market economy people do not have equal opportunity who are less able to produce what others want. [...] This means that market allocations must be corrected in order to bring some people closer to the share of resources they would have had but for these various differences of initial advantage, luck, and inherent capacity."
Um von unterschiedlichen Ausstattungen zu (annähernd) gleichen Chancen zu gelangen, muß also ein gerechtes Konzept der (beschränkten) Ungleichverteilung entwickelt werden, welches nur bestimmte Ungleichheiten kompensiert, um über die gleichen Chancen im freien Konkurrenz-Markt später wieder gerechte Ungleichverteilung zuzulassen.
Ursprüngliche Ungleichverteilung interner Ressourcen -> begrenzte Ungleichverteilung externer Ressourcen -> gerechte Gleichverteilung -> Möglichkeit gerechter Ungleichverteilung durch unterschiedliche Lebenspläne.
Je nachdem, wie stark auf die individuelle Unterschiedlichkeit der Menschen eingegangen wird, und welches Ziel sich die gerechte Verteilung genau steckt, wird sie sich nach Dworkin in zwei verschiedenen Modellen gestalten. Entweder als Wohlergehensgleichheit oder als Ressourcengleichheit.
"The first (which I shall call equality of welfare) holds that a distributional scheme treats people as equals when it distributes or transfers resources among them until no further transfer would leave them more equal in welfare. The second (equality of resources) holds that it treats them as equals when it distributes or transfers so that no further transfer would leave their shares of the total resources more equal."
Dworkin vertritt die Richtung der Ressourcengleichheit. Doch bevor seine Strategie beschrieben wird, soll zunächst erklärt werden, warum er den Versuch der "equality of welfare" für untauglich hält.
Wenn Wohlergehensgleichheit wirklich konsequent verfolgt wird, muß sie es leisten, die mit dem individuellen Wohlergehen verbundenen Bedürfnisse für alle gleichermaßen zu befriedigen. Da die Verteilung, die hier vorgenommen wird, in einer komplexen (wohl auch z.T. anonymisierten) Gemeinschaft vollzogen wird, sind Institutionen nötig, die die Verteilung organisieren. Sie werden für eine gerechte Verteilung alle denkbaren Informationen über die Fähigkeiten, Ausstattungen und Bedürfnisse aller Individuen benötigen. Wo die Information beschränkt ist, wird im Zweifelsfalle nur die gleiche Möglichkeit zur Wohlergehensgleichheit geschaffen werden, was letztlich einer Ressourcengleichheit nahe kommt. Alle Lösungen, bei denen die Information nicht als ideal angesehen werden oder von Betroffenen zu Recht kritisiert werden können, werden Mischformen aus Wohlergehens- und Ressourcengleichheit sein; die Lösung für keine Information wird die Ressourcengleichheit sein.
"If a welfare-egalitarian knows nothing of this sort about a large group of citizens, he may sensibly decide that his best strategy for securing equality of welfare would be to establish equality of income"
Das große Problem der Institutionen wird sein, welche Bedürfnisse sie berücksichtigen sollen, und wie sie an umfangreiche Informationen über die Bedürfnisse gelangen, ohne die Privatsphäre der Personen zu verletzen. Dworkin ist generell der Ansicht, daß nur beschränkte Formen der Wohlergehensgleichheit praktikabel sind, die immer einzelne Gruppen oder Einzelpersonen unberücksichtigt lassen und so Legitimationsprobleme haben werden.
Das Ziel der Gerechtigkeit durch Gleichheit stößt also, verstanden als institutionell erzeugte Gleichheit des individuellen Wohls, auf zu viele Probleme. Dworkins einfachere Lösung der Ressourcengleichheit möchte Ungleichheit nur dort gestatten, wo sie gegenüber absoluter Gleichverteilung gerechtfertigt in bezug auf das Ziel der wirklichen Chancengleichheit erscheint. Tatsächlich gleiches individuelles Wohl muß dadurch nicht erzeugt werden. Sein Konzept startet mit der Idealvorstellung eines Konkurrenzmarktes unter gleichen Bedingungen.
Die Auktion
Bei Dworkin sehen sich die Beteiligten anfänglich in einer Auktion einer bestimmten Menge von Gütern gegenüber, die sie mit gleichen Fähigkeiten und gleicher Kaufkraft ersteigern können (es kann allerdings auch beschlossen werden, daß ein Teil der Güter Gemeineigentum wird und somit nicht zu ersteigern ist). Diese Auktion spiegelt die Idealform eines freien Marktes wider. Es wird nicht vorausgesetzt, daß die Güter so beschaffen sein müssen, daß sie einem Konsens gleicher Grundinteressen entsprechen. Dworkin geht vielmehr davon aus, daß die Lebenspläne äußerst unterschiedlich sind; somit werden auch die Güter zu ihrer Verwirklichung ungleich sein können.
Ausgegangen davon, daß die vorhandenen Güter in unterschiedlicher Zusammenstellung gleich gut oder schlecht auf die Lebenspläne der Betroffenen passen, könnte die ursprüngliche Verteilung optimal und gerecht ablaufen, da jede Person für den gleichen Gegenwert genau das ersteigert, was ihr am liebsten ist.
Somit würde die Ausgangssituation den Neidtest (envy test) bestehen, wenn bei Beendigung der Auktion alle Beteiligten neidfrei sind (dafür kann die Auktion bei Bedarf mehrere Durchgänge haben). Wenn die vorhandenen Güter nicht auf alle Lebenspläne gleichermaßen passen, so werden zwar nicht alle in gleicher Weise zufrieden sein (manche könnten sie als für sie unvorteilhaft bewerten), ungerecht behandelt würde aber trotzdem niemand.
Diese Überlegung abstrahiert allerdings nicht zuletzt deshalb zu stark von einer realistischen Ausgangssituation, weil die Beteiligten mit Sicherheit nicht mit der gleichen natürlichen Ausstattung in die Auktion treten. Dabei werden ihre eventuellen Benachteiligungen weder in bezug auf ihre späteren zusätzlichen Aufwendungen, noch auf ihre Fähigkeiten im Auktionsbetrieb ausgeglichen. Es müsste also eine Angleichung der Fähigkeiten und eine Angleichung der tatsächlich frei verfügbaren Mittel vollzogen werden. Eine einfache Überlegung wäre, dies allein durch eine Umverteilung der Mittel vor der Auktion zu gewährleisten, da bei der ursprünglichen Ressourcenverteilung ja nur materielle Gleichheit thematisiert wird.
Das ist allerdings keine befriedigende Lösung, da die wenigsten natürlichen Benachteiligungen finanziell kompensiert werden können. Welche Benachteiligung soll wie intensiv kompensiert werden? Wie stehen - gegenüber der Norm - Benachteiligte da, wenn sie gut finanziell unterstützt werden, und wie, wenn dies auf ihre Fähigkeiten und auf ihr Wohlbefinden fast gar keinen Einfluß hat? Diese Fragen kann eine einfache materielle Gleichverteilungsidee nicht beantworten.
"Keine Geldsumme kann dem Schwerbehinderten die Lebensqualität der Gesunden verschaffen."
Und wäre es überhaupt annehmbar, wenn die Auktionsmittel so stark umverteilt würden, daß einem Schwerbehinderten mit der maximalen Umverteilung immer noch wenig geholfen ist, während dem Rest der Betroffenen zum Ersteigern fast nichts bleibt?
Die Versicherung
Um den Umfang einer Angleichung der natürlichen Gaben genau festzulegen, schlägt Dworkin ein Versicherungsmodell vor, das verhindern soll, daß die Begabten versklavt werden, aber die Risiken, denen alle mehr oder weniger ausgeliefert sind, minimiert werden können. Da diese Versicherung nicht alle Benachteiligungen, insbesondere nicht solche, die kaum materiell kompensierbar sind, ausgleichen kann, bezeichnet Dworkin nach Kymlicka diese Lösung als die nur zweitbeste, aber praktikabelste.
Um nur die nicht selbstverschuldeten Ungerechtigkeiten zu berücksichtigen, unterscheidet Dworkin zwischen Glück oder Pech, das entweder auf selbstbestimmte Entscheidungen ([bad/good] option luck) oder, das auf unbeeinflussbare Fremdeinwirkung ([bad/good] brute luck) zurückzuführen ist. Risiken, die bewußt gewählt werden und zu Ergebnissen führen, die als "Pech" bezeichnet werden können, sind nicht immer ungerecht und müssen somit auch von der Gemeinschaft nicht mitgetragen werden.
Krebs zu bekommen ist "bad brute luck", Lungenkrebs durch Kettenrauchen zu bekommen jedoch kann als "bad option luck" eingestuft werden. Eine Entschädigung für Benachteiligungen von Geburt an sollten nur soweit berücksichtigt werden, wie sie auf "bad brute luck" zurückführbar ist. Alle Personen, die in dieser Weise unter ein als normal eingestuftes Niveau fallen, haben das Recht auf Entschädigung, da sie mit geringerer Ausstattung in die Auktion eintreten.
"[...] someone who is born handicapped starts with less by the way of resources than others have, and should be allowed to catch up, by the way of transfer payments, before what remains is auctioned off in any equal market."
Das gleiche gilt für das von der Versicherung gedeckte Pech im Verlauf des individuellen Lebens.
Die Versicherungsprämie, die alle zahlen müssen und sich dadurch eine Versicherung kaufen, wird über einen Steuersatz auf alles verfügbare Vermögen eingetrieben. Zwar hat diese Versicherung für alle, die davon in ihrem Leben keinen Gebrauch machen, keinen unmittelbarem Vorteil. Zumindest sollte aber ihr Umfang im gesellschaftlichen Konsens ermittelt werden. Im weiteren Verlauf werden Steuern auch auf Einkommen erhoben, um den ungerechterweise Benachteiligten einen Anteil am Erfolg der gemeinschaftlichen ökonomischen Leistung zu ermöglichen, ohne jedoch durch die Höhe der Steuersätze individuelle Leistungsbereitschaft zu bestrafen. So bleibt auch der Auktionsgedanke nicht nur als "starting-gate" bestehen, sondern soll von Tag zu Tag wirken und in der Gemeinschaft fest verankert werden.
Die Idee ist, BürgerInnen einen staatlichen Transfer zu bieten, der ihnen ein Einkommen etwas unterhalb des Einkommensniveaus bietet, das sie hätten, wenn "brute luck" vollkommen ausgeschaltet wäre. Die Prämie, die jede/r von seinem Einkommen zahlt, ist einkommensabhängig und belastet somit alle gleichermaßen (genauer soll hier auf das Modell nicht eingegangen werden).
Dworkin ist der Ansicht, durch dieses fiktive Verfahren sei jedem/r einsichtig, daß es sich lohnt, Risiken und Benachteiligungen so gut es geht im Einklang mit Leistungsbelohnung abzuschwächen.
Vorteile sieht Dworkin gegenüber Rawls in seinem Ansatz v.a. bezüglich der Feinabstimmung der berücksichtigten Ungerechtigkeiten. Rawls könnte Behinderte nicht entschädigen, wenn sie nicht zur Gruppe der "worst-off" gehören, obwohl sie von "bad brute luck" getroffen sind. Ganz allgemein äußert Dworkin eine Kritik, die gegenüber Rawls noch immer aktuell ist: Rawls' Theorie schlägt insgesamt bei allen benachteiligten Gruppen und Individuen über der Klasse der "worst-off" fehl.
"From the standpoint of our conception, the difference principle is not sufficiently fine-tuned in a varieety of ways. [...] In particular, the structure seems insufficiently sensitive to the position of those with natural handicaps, physical or mental, who do not themselves constitute a worst-off group, because this is defined economically, and would not count as the representative or average member of any such group. [...] It has often benn pointed out, moreover, that the difference principle is insufficiently sensitive to variations in distribution above the worst-off economic class."
Übertragen auf die wirkliche Lebenspraxis bereitet das Modell Dworkins leider auch in einer weniger ‚revolutionären‘ Form noch Schwierigkeiten.
Neben dem Problem der angemessenen Kompensation der Benachteiligung wird schwer zu trennen sein, welche Benachteiligungen unbeeinflussbar sind und welche auf individuelle Entscheidungen bezüglich des Lebensweges zurückzuführen sind. Zudem ist es generell schwer entscheidbar, welche Fähigkeiten als normal, herausragend oder defizitär gelten können. Dworkin schlägt eigentlich nur die Einführung unterschiedlicher Steuern zur Umverteilung vor.
"Dworkins Antwort ist vielleicht recht enttäuschend: Man besteuert die Reichen, obwohl manche nur aufgrund ihrer Anstrengungen und nicht wegen natürlicher Vorteile reich sind, und läßt es den Armen zugute kommen, obwohl manche, [...], aufgrund ihrer Entscheidungen arm sind und nicht wegen natürlicher Nachteile."
Insgesamt besteht die größte Schwäche in Dworkins Konzept vielleicht darin, daß er eine formal überzeugende Theorie der Gerechtigkeit vorlegt, die sich aus Defiziten des Rawlsschen Ansatz bei Verteilungsfragen ergibt, in der Umsetzung aber immer weiter von den erhaltenswerten Idealen Abschied nehmen muß und so zu einem konservativen und groben Verteilungsmodell führt, das individueller Benachteiligung nur mangelhaft entgegen kommt.
Dennoch läßt sich auch mit seinem Ansatz eine soziale Grundsicherung rechtfertigen. Mit der starken Einstiegsidee der Eigentumsgleichheit geht er sogar noch über eine Grundsicherung hinaus. Zwar bleibt das Marktsystem erhalten, es macht aber gerechterweise nur Sinn, wenn an ihm auch alle gleichermaßen beteiligt sein können. Alle Ungleichheiten müssten soweit wie möglich vor dem Eintritt in den Konkurrenzmarkt ausgeglichen werden. Die Grundsicherung würde dann in Form eines Einstiegsvermögens zuzüglich eventueller Zulagen bei natürlicher Benachteiligung bestehen und i.d.R. weit über dem Existenzminimum liegen, wenn nicht die zu verteilenden Ressourcen in einzelnen Fällen äußerst mager sind.
In der Umsetzung der Idee der Eigentumsgleichheit gibt sich Dworkin (wie schon angedeutet) bescheidener. Was speziell die Armutsvermeidung angeht, äußert er sich u.a. folgendermaßen:
"A substantial minority of Americans are chronically unemployed or earn wages below any realistic ‘poverty line’ or are handicapped in various ways or burdened with special needs; and most of these people would do the work necessary to earn a decent living if they had the opportunity and capacity. Equality of ressources would require more rather than less redistribution than we now offer."
Als Reformvorschlag gerade bezüglich des Schutzes eines Mindesteinkommens schlägt er wie Rawls eine NIT vor. In dieser Form soll eine minimale Identifizierung aller Personen mit der Gemeinschaft ermöglicht werden.
"Perhaps a more general form of transfer, like a negative income tax, would prove on balance more efficcient and fairer, in spite of the difficulties in such schemes."
1.3 Sen
Kritik an Rawls und dem Utilitarismus
Amartya K. Sen betrachtet die Rawlssche Lösung des Utilitarismusproblems als unzureichend. In einer frühen Antwort auf Rawls vergleicht er das utilitaristische Verfahren mit dem Rawlsschen des Maximin und dem modifizierten des lexiographischen Maximin. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, daß sowohl die utilitaristische Regel (UR) als auch die Maximin-Regel (MR) und die lexiographische MR (LMR) unvollständig in bezug auf hinreichende Beurteilung interpersoneller Wohlfahrtsvergleiche sind.
Mit der UR lassen sich ausschließlich Vergleiche von Gewinn und Verlust verschiedener Personen bei unterschiedlichen Verteilungen betrachten, mit dem Rawlsschen Modell nur Vergleiche von Niveaus. Als Grundlage hinreichender ethischer Urteile müsse aber nach Regeln entschieden werden, die beide Vergleiche berücksichtige.
"Letzten Endes ist das Argument vernünftig, daß man sich bei der ethischen Beurteilung von Verteilungsproblemen [...] typischerweise sowohl mit Vergleichen von Wohlfahrtsniveaus als auch mit Vergleichen von Gewinnen und Verlusten für die Wohlfahrt befaßt. [...]; denn beide übersehen jeweils eine Hälfte des Gesamtbildes völlig."
Wenn beispielsweise ein Kuchen unter der Voraussetzung aufgeteilt würde, daß die bei der Aufteilung berücksichtigten Personen gerne soviel vom Kuchen hätten wie möglich, sich ihr Zugewinn an Wohlfahrt aber mit steigendem eigenen Besitz von Kuchenmenge abschwächt, soll nun die Verteilung mit Hilfe der Regeln (UR; MR; LMR) vollzogen werden. Sen stellt fest, daß jede Regel mindestens eine der von ihm aufgestellten Axiome verletzt:
Es besagt, daß (gleiche Wohlfahrtsfunktionen vorausgesetzt) eine Umverteilung von der reicheren zugunsten der ärmeren Person immer dann vorzuziehen ist, wenn dadurch das Verhältnis nicht genau umgekehrt wird.
"Das Axiom der symmetrischen Präferenz begünstigt einfach die Reduktion von Ungleichheit, wenn die Personen identische ‘Bedürfnisse’ besitzen."
Wenn zwei Personen mit insgesamt vergleichbarem Einkommensniveau nicht gleichgestellt sind, dann sollte in bezug auf die Verteilung die schlechter gestellte Person auf jeden Fall nicht weniger erhalten als die andere.
"Das Axiom der schwachen Gleichheit fordert, daß eine Person, die in anderen Hinsichten als der des Einkommens schon mehr entbehrt, nicht auch noch weniger Einkommen erhalten sollte."
Wenn drei Personen ungleich gestellt sind, wobei zwischen der schlechtest gestellten Person (k) und der zweitschlechtest gestellten (j) ein geringerer Unterschied herrscht als von der bestgestellten (i) zur zweitschlechtest gestellten (j), ist eine Umverteilung von k zu j dann gerechtfertigt, wenn zugleich eine stärkere von i zu j stattfindet.
"Das AMÜ besagt, daß eine die Ungleichheit vergrößernde Übertragung durch eine genügend große, die Ungleichheit vermindernde Übertragung ausgeglichen werden kann."
In einem aufwendigen Verfahren der formal-logischen Ableitung beweist Sen daraufhin folgende Thesen:
"(T.1) Die utilitaristische Regel verstößt bei einer Schar zulässiger individueller Wohlfahrtsffunktionen gegen das Axiom der schwachen Gleichheit.
(T.2) Die Maximin-Regel verstößt bei einer Schar zulässiger individueller Wohlfahrtsfunktionen gegen das Axiom der symetrischen Präferenz sowie gegen das Axiom der Mitübetragung.
(T.3) Die lexiographische Maximin-Regel kann bei einer Schar zulässiger individueller Wohlfahrtsfunktionen gegen das Axiom der Mit-Übertragung verstoßen.
(T.4) Es gibt Entscheidungsregeln, die jedem der drei Axiome [...] bei allen individuellen Wohlfahrtsfunktionen genügen."
Seine abschließende Bewertung läuft darauf hinaus, daß er von der UR behauptet, sie lasse eine Umverteilung nur zu, wenn ein Gewinn auf einer Seite (egal welcher) einem geringeren Verlust auf der anderen gegenüberstehe. Die MR läßt eine Umverteilung zu, wenn bei zwei unterschiedlichen Wohlfahrtsniveaus das geringere durch Umverteilung angehoben werden könnte, während die Person mit dem höheren Niveau auch irgendeinen Vorteil haben sollte. Sein Vorschlag ist nun, beide Zielrichtungen zusammenzufassen, um eine umfangreiche Verteilungsregel zu gewinnen. Eine genaue Antwort bleibt er bedauerlicherweise zunächst schuldig.
Während die Idee, sowohl Wohlfahrtsniveaus als auch Gewinn und Verlustrechnungen in eine Verteilungsregel einzubeziehen, grundsätzlich nachvollziehbar ist, wirft Sens Begründung doch einige Fragen auf. Es stellt sich die Frage, warum denn nach Konfliktfreiheit mit den aufgestellten Axiomen gesucht werden sollte, Sen liefert dafür strenggenommen keine Gründe. Selbst wenn Sens streng logische Begründung funktioniert, muß sie doch bezüglich Rawls' Überlegungen nicht unbedingt folgenreich sein.
T.1 wurde schon von Rawls begründet; T.2 geht einfach davon aus, daß das ASP und das AMÜ der Rawlsschen Grundsätze vorzuziehen sind. Während das ASP (welches ein stark egalitäres Axiom ist) noch prinzipiell in Rawls' Überlegung mit einbezogen wird (aber begründeterweise von ihm durch das Differenzprinzip ersetzt wird), scheint AMÜ dem Differenzprinzip einfach zu widersprechen und ist deshalb auf diesem Hintergrund nicht überzeugend. T.3 hat auch wenig Wirkungskraft, da sie auf dem fragwürdigen AMÜ aufgebaut ist. Zudem fällt auf, daß Sen keine brauchbare Lösung des Problems anbietet.
Sens Einwände gegen Rawls und sein Gegenvorschlag werden in den Tanner Lectures etwas klarer. Hier weist er auf die Einbeziehung konkreter Einzelfälle hin (case-implication perspective). Rawls’ "prior-principle perspective" setzte ihm zufolge an der falschen Stelle an und sei im Übergang zu "un-original, i.e., real-life positions" nicht direkt anwendbar.
Ein Nutzenprinzip müsste so formuliert werden, daß es nur dann ein solches ist, wenn es allen gleichermaßen nutzt. Ansonsten wäre der die Ressourcen ineffizient nutzende Krüppel doppelt bestraft: einerseits durch seine Behinderung, andererseits durch den Entzug von Ressourcen.
Während der Grenznutzen (utilitarian equality) eine kontrafaktische Sichtweise ist (welchen zusätzlichen Nutzen würden wir erhalten, wenn einer Person eine zusätzliche Einkommenseinheit gewährt würde?), ist "total utility equality", so Sen, die Orientierung an der Leximinregel. Es wird immer so umverteilt, daß (soweit möglich) Nutzengleichheit erreicht wird. Während utilitarian equality eine Verteilung mit dem Nutzenergebnis 4:1 (oder 10:1) für zwei Personen vorziehen würde, gilt nach total utility equality das Ergebnis 3:2 als gerechter.
Sen behauptet, daß Rawls' Maximin-Regel ein solcher Utilitarismus zugrundeliegt, der bei ihm nur in eine spezielle "worst-off" Variante gewandelt wurde. Sen hat drei Schwierigkeiten mit dieser Überlegung insbesondere auf Rawls' Interpretation bezogen. Für ihn bleibt unklar
Sein Vorschlag einer Modifikation würde zumindest die Bewertung verschiedener Wohlfahrtspositionen so festlegen, daß Interessen immer genau einer worst-off-Position denen einer better-off-Position entgegengehalten werden. Sen behauptet also, daß einerseits utilitaristische Ansätze stärker modifizierbar sind, als Rawls es unternommen habe. Andererseits benutze Rawls selbst nur eine Variante des Utilitarismus. Seine Kritik sei also nicht gegen den Utilitarismus wirksam, sondern stelle eine generelle Kritik des "welfarism" dar. Sen teilt Rawls' Ablehnung der Berücksichtigung individuellen Wohls nicht. Er empfindet Rawls' Differenzprinzip mit der Einbeziehung der Grundgüter sogar als höchst unplausibel. Während eine strenge Leximinregel zugunsten des Krüppels verteilen würde, der klassische Utilitarismus aber zu dessen ungunsten, verhält sich Rawls diesem Problem gegenüber neutral, zumindest was die reine, individuelle Nutzenbenachteiligung des Krüppels angeht.
"The primary goods approach seems to take little note of the diversity of human beings. [...] If people were basically very similar, then an index of primary goods might be quite a good way of judging advantage. But, in fact, people seem to have very different needs [...]. Indeed, it can be argued that there is, in fact, an element of ‘fetishism’ in the Rawlsian framework. Rawls takes primary goods as the embodiment of advantage, rather then taking advantage to be a relationship between persons and goods. [...] welfarism does not have this fetishism, since utilities are reflections of one type of relation between persons and goods."
Der "capability approach"
Doch wie lautet nun Sens Antwort genau? Daß natürliche Fähigkeiten der Betroffenen in die Verteilung mit einbezogen werden, sollten ist schon von Dworkin aufgegriffen worden. Er hält den Ansatz des welfarisms für unpraktikabel und schlägt deshalb die Ressourcengleichheit vor dem Konkurrenzmarkt vor. Warum sollte jetzt laut Sen doch das individuelle Wohlergehen in gerechte Verteilungsprinzipien miteinbezogen werden, und wie?
Sen sagt, das Problem sei der fehlende Bezug auf die individuellen Grundfähigkeiten. Sein Gleichheitskonzept soll demnach "basic capability equality" heißen und legt besonderen Wert auf die Berücksichtigung der grundsätzlichen Handlungsfähigkeiten jeder einzelnen Person.
"The ability to move about is the relevant one here, but one can consider others, e.g., the ability to meet one’s nutritional requirements, the wherewithal to be clothed and sheltered, the power to participate in the social life of the community. [...] The focus on basic capabilities can be seen as a natural extension of Rawls concern with primary goods, shifting attention from goods to what goods do to human beings."
Wirklich neu ist diese Sichtweise wahrscheinlich nicht, doch könnte es gelingen, die Grundgüter für unterschiedliche Kulturen, Subkulturen, Gemeinschaften oder Individuen passender zu bestimmen, wenn die relevanten Daten über Bedürfnisse und Fähigkeiten ermittelbar währen. Laut Sen ist das zwar nicht einfach, aber auch nicht wesentlich komplizierter, als die Grundgüter in Rawls' Urzustand zu ermitteln. Offen bleibt immer noch, wie das Verfahren genau ablaufen soll und ob das gewählte Verfahren nicht zusätzliche Probleme bezüglich der Gerechtigkeitsfragen schafft.
Die entscheidende Gleichheitsfrage stellt sich für Sen nicht generell (ob Gleichheit oder nicht), sondern für welche Bereiche, in welchen Fällen, da sich die Gleichheit immer auf Vergleiche zweier Zustände bezüglich einer Sache stellt. Sen behauptet, alle Gerechtigkeitstheorien bezögen sich explizit (Rawls - primary goods; Dworkin - equality of resources) oder implizit auf die Gleichheit bezüglicher bestimmter Gegenstände (selbst bei den Gegnern: Nozick - "equality of libertarian rights"; Frankfurt - "equal satisfaction of needs"). Die Frage, in welcher Hinsicht und in wiefern Gleichheit geschaffen werden muß und die Begründung der Antwort kann nicht generell, sondern muß fallspezifisch gestellt bzw. formuliert werden.
Die zweite Scheinfrage ist für Sen die nach Freiheit oder Gleichheit. Gleichheit kann sowohl Freiheit in begrenztem Rahmen verringern als auch in einem anderen Bereich erhöhen. Es geht nicht primär um die Gleichverteilung als solcher, sondern um die damit verbundene Möglichkeit der Entfaltung allgemeiner menschlicher Bedürfnisse und individueller Lebenspläne. Die Unterschiedlichkeit der Menschen fordert eine begrenzte Ungleichbehandlung, da gleiche Handlungsfreiheiten möglicherweise nicht durch gleiche Ausstattung erreicht werden kann.
"The resource a person has, or the primary goods that someone holds, may be very imperfect indicators of the freedom that the person really enjoys to do this or be that."
Weder der Ansatz von Rawls, noch der von Dworkin ist demnach erfolgreich bezüglich interpersoneller Freiheitsvergleiche, so Sen. Eine direktere Aussage über tatsächliche Freiheiten läßt der Sensche Ansatz der Fähigkeiten (capabilities) zu. Ausdifferenziert auf unterschiedliche Lebensbereiche läßt sich so die Handlungsfähigkeit einer Person feststellen. Die individuellen Fähigkeiten der Personen haben einen klareren Bezug auf ihr gesamtes Wohlfahrtsniveau und auf den Umfang der Freiheit, den sie genießen.
"Closely related to the notion of functionings is that of the capability to function. It represents the various combinations of functionings (beings and doings) that the person can achieve. Capability is, thus, a set of vectors of functionings, reflecting the person’s freedom to lead one type of life or another."
Während "primary goods", "resources" und "real income" das weitere Umfeld der Freiheit begründen, hat die Gesamtfähigkeit nach Sen konstitutiven Einfluß auf das Wohlbefinden, da Entscheidungsfähigkeit und freie Wahl wesentliche Bestandteile des menschlichen Lebens seien.
Der interpersonelle Vergleich von Gesamtfähigkeiten benötigt die Bestimmung derjenigen Werte, die in diesem Zusammenhang als relevant angesehen werden. Im Gegensatz zum Utilitarismus sind diese Werte nicht solche, die mentale Zustände umfassen, sondern vielmehr Handlungen und Gesamtverfassungen als solche. Zwar hat ein Set von ausgewählten Fähigkeiten, die der Verwirklichung der Person dienen, auch Einfluß auf ihr Wohlbefinden, nutzentheoretisch läßt sich der Wert der Freiheit trotzdem nicht vollständig auflösen. Im Bewertungsverfahren sollen alle verfügbaren Daten über die wichtigen Aufgaben gesammelt und ausgewertet werden, die Gesamtfähigkeiten illustrieren. Kompromisse im Umfang können mit Blick auf die eigentlichen Ziele und den kontingenten Umständen der Informationsgewinnung geschlossen werden. Die Aussagen, die so getroffen werden könnten, hätten viel direkteren Einfluß auf den Grad der Ungleichheit in einem sozialen Zusammenhang, da sie sich nicht auf mentale Zustände der Betroffenen allein beziehen.
"A thoroughly deprived person, leading a very reduced life, might not appear to be badly off in terms of the mental metric of desire and ist fulfilment, if the hardship is accepted with non-grumbling resignation. In situations of longstanding deprivation, the victims do not go on grieving and lamenting all the time, and very often make great efforts to take pleasure in small mercies and to cut down personal desires to modest -‘realistic’- propotions. [...] The extent of a person’s deprivation, then, may not at all show up in the metric of desire-fulfilment, even though he or she may be quite unable to be adequatly nourished, decently clothed, minimally educated, and properly sheltered."
Neben der Garantie formaler Freiheit als Grundprinzip und der Ausstattung mit Grundgütern als sozialer Grundwerte (Einkommen und Wohlstand, freie Wahl des Berufes und Aufenthaltsortes, freier Zugang zu Ämtern, soziale Anerkennung), die er mit Rawls teilt, scheint Sen noch einen handlungs- oder entfaltungstheoretsichen Ansatz zu vertreten, der Freiheit in einem ausübenden Sinne versteht, so daß diese Freiheit zu ermitteln nicht allein über die Garantie formaler Freiheit und der Ausstattung mit Mitteln zu deren Förderung erreicht werden kann. Sen berücksichtigt die natürliche Ausstattung, die Ziele und die Fähigkeit, diese Ziele zu erreichen. Dazu legt er offensichtlich Wert darauf, die konkreten Handlungsvorgänge zu beobachten, die das Zusammenspiel der drei Faktoren aufzeigen.
Sen hat das Konzept der Grundfähigkeiten schon in Untersuchungen über Benachteiligungen, insbesondere über Armut, einfließen lassen. Die Sensche Armutsmessung im Bereich der Niedrigeinkommen als Kombination aus head-count ratio, income gap und distribution of income wurde schon im Teil A vorgestellt. Hier soll die Armutsmessung als ein Beispiel für den Senschen Fokus auf "basic capabilities" gegenüber dem "means"-Ansatz herangezogen werden.
Reine Einkomensmessung gibt Sen zufolge nur ungenügende Auskunft über den tatsächlichen Zustand der untersuchten Person, Gruppe, Schicht oder Klasse hinsichtlich des Mangels oder der Benachteiligung im umfassenden Sinne. Somit läßt sich Armut nicht allein über Niedrig- oder Niedgrigsteinkommen bestimmen. Zwei Personen der unteren Einkommensschichten können mit exakt den gleichen Grundgütern und dem gleichen Einkommen ausgestattet sein, trotzdem kann eine ärmer sein als die andrere. Und zwar deshalb, weil sie (etwa wegen einer Behinderung) nicht nur höhere laufende Ausgaben, sondern insgesamt größere Schwierigkeiten hat, ihre Aufgaben mit ihren Fähigkeiten zu erfüllen und so auch in stärkerer Abhängigkeit von gegebenen Einrichtungen ist.
"If we want to identify poverty in terms of income, it cannot be adequate to look only at incomes (i.e. generally low or high), independently of capability to function derivable from those incomes. Income adequacy to escape poverty varies parametrically wirth personal characteristics and circumstances. [...] To have inadequate income is not a matter of having an income level below an externally fixed poverty line, but to have an income below what is adequate for generating the specified levels of capabilities for the person in question."
Unangemessenheit geht demnach über die reine Mäßigkeit von Einkommen. Diese fallspezifische Ansicht darf natürlich der subjektiven Armut nicht zuviel Raum lassen. Das reine Empfinden, man sei trotz hohen Einkommens und der Fähigkeit, seine Aufgaben zu erfüllen, nicht in der Lage, die gesetzten Ziele zu erreichen und deshalb unglückliche, kann nicht dazu führen, objektiv als unter Mangel leidend und damit als arm eingestuft zu werden. Sen schlägt deshalb vor, Einzelpersonen verschiedenen Kategorien zuzuordnen, denen dann die benötigten Mittel zu ihrer spezifischen Problembehebung zugewiesen werden. Eine Antwort auf die Frage, warum in Industrieländern immer noch viele Menschen weit überhalb der absoluten Armutsgrenze eine geringere Lebenserwartung als andere, absolut arme haben, liegt nach Sen in der schlechten Verteilung der Gesundheitsleistungen. Eine andere in der Tatsache, daß in bestimmten sozialen Konstellationen relativer Mangel zur völligen Verlust von Fähigkeiten (capabilities) führen kann.
"In a country that is generally rich, more income may be needed to buy enough commodities to achieve the same social functioning, such as ‘appearing in public without shame’. The same applies to the capability of ‘taking part in the life of the ,community’. These general social functionings impose commodity requirements that vary with what others in the community standardly have."
An Sens Rawlskritik sowie an seinem eigenen Vorschlag überzeugt vor allem sein handlungstheoretischer Ansatz. Gerade was die Bestimmung der und den Umgang mit den "worst-off" angeht, würde die Rücksichtnahme auf "basic capabilities" zu anderen Ergebnissen kommen als Rawls. Die profitierende Gruppe könnte genauer und gerechter bestimmt und gefördert werden. Undeutlich bleibt aber, wie sich Sen dem Problem der inadequaten Informationsmenge entziehen will. Gerechte Einzelfallentscheidungen bedeuten nicht nur einen hohen Aufwand und verletzen im Zweifelsfalle die Privatsphäre, sondern müssen die Vollständigkeit und Wahrheit der notwendigen Informationen nachweisen. Andernfalls kann das Urteil immer als falsch und ungerecht betrachtet werden. Die Forderung ‘alle Information oder keine’ wird wohl eher darauf hinauslaufen, weiterhin nach möglichst objektiven und generalisierten Kriterien zu urteilen.
1.4 Roemer, Cohen und Arneson
Das Ausbeutungsproblem
Bisher wurden noch mindestens zwei entscheidende Punkte der Gerechtigkeitsfrage vernachlässigt.
1. Die Verteilung richtete sich nur auf bereits vor jeder (Arbeits- und Konsum-) Marksituation bestehende Güter bzw. auf die bereits produzierten Güter. Es wurde vernachlässigt, ob unter ungerechten Verhältnissen produzierte Güter überhaupt gerecht verteilt werden können. Deshalb sollte der Produktionsprozeß genauer untersucht werden.
2. Es wurde vorwiegend zu beantworten versucht, in welchen Fällen und in welcher Form gerechterweise umverteilt werden muß, nicht aber in welchen Fällen nicht umverteilt werden darf. Diesem Punkt widmet sich u.a. der libertäre Ausbeutungsansatz (Grundsatz des Selbsteigentums).
Wenn wir uns allesamt als gleiche und freie Personen anerkennen, so dürfen wir uns in keiner Weise in diesem Sinne einschränken. Sind wir zwar als Einzelne biologisch nicht verantwortlich für unser individuelles Dasein, so sind wir es doch für unseren Lebensweg. Wenn niemand das Recht hat, für uns Entscheidungen zu treffen, die unser Leben betreffen, und niemend das Recht hat, von unseren Entscheidungen zu profitieren, so kann uns auch niemand zwingen, die Produkte unserer Arbeit mit anderen zu teilen. Werden wir dazu gezwungen, wird unser Recht auf Selbstbestimmung und Selbsteigentum verletzt. Die Gegener (z.B. Rawls, Dworkin, van Parijs) einer solchermaßen radikalen Formulierung behaupten, daß wir weder ein Recht auf die gesamten Produkte unserer Arbeit haben, noch, daß wir uns als Einzelne gänzlich selbst gehören. Zudem hat das uneigeschränkte Recht auf Selbsteigentum Nachteile auf die praktische Entfaltungsmöglichkeit unserer Person und maximiert die wirkliche Freiheit nicht.
Die Produktionsgerechtigkeit, die Kritik an der formalen Rechtsgleichheit, die Frage nach "echten" Bedürfnissen und nichtentfremdeter Arbeit sind einige der Hauptthemen der marxistischen Theorie. Besonders dort, wo es um gerechtigkeitsrelevante Ausbeutung geht, treffen die neo- oder analytisch-marxistischen Ansätze und die libertären Prinzipien aufeinander.
Zwar gehören auch bei Rawls und Dworkin "die Produktionsmittel zu den gesellschaftlichen Gütern, die gemäß einer Gerechtigkeitstheorie verteilt werden müssen" (Kymlicka 1996, S. 136). In ihrem favorisierten Konkurrenzmarkt wird aber zugelassen, daß (bei nicht zu großen Einkommensunterschieden) Abhängigkeit von Lohnarbeit als auch Macht innerhalb des Produktionsprozesses fortbestehen.
"Man sollte sich auf die Eigentumsverhältnisse konzentrieren, denn diese verschaffen einigen nicht nur ein höheres Einkommmen, sondern auch eine gewisse Kontrolle über das Leben anderer. Bei einer stark umverteilenden Besteuerung hat vielleicht ein Kapitalist und ein Arbeiter das gleiche Einkommen, aber der Kapitalist könnte immer noch bestimmen, wie der Arbeiter einen großen Teil seiner Zeit verbringt, nicht aber umgekehrt."
Hier wird insgesamt die Sphäre der Aneignungsgerechtigkeit gegenüber der Verteilungsgerechtigkeit geöffnet. Falls also Privateigentum (an Produktionsmitteln) und ein freier Konkurrenzmarkt zugelassen werden, ist darauf zu achten, welche Folgen eine (unter liberalen Gesichtspunkten gerechte) Ungleichverteilung im Produktionsbereich für die benachteiligten Mitglieder hat. Einige ‚Hardliner‘ mögen behaupten, Verteilungsgerechtigkeit und Produktionsungerechtigkeit gingen überhaupt nicht zusammen. Untersucht werden müsste aber zunächst, in welchen Fällen Privateigentum an Produktionsmitteln überhaupt Ungerechtigkeiten z.B. bezüglich der Entfremdungs- oder Ausbeutungsthese schafft.
Eine wesentliche Komponente der Analyse des Produktionsprozesses ist der Arbeitsbegriff. Wenig hilfreich ist der konservative Ansatz vieler Sozialisten, der, wie auch der kapitalistische, an einem unkritischen Leistungsbegriff festhält. Gerechtigkeit im Produktionsprozeß sei dann geschaffen, wenn die Arbeit (die allein Wert schafft) gerecht entlohnt würde, und zwar nach Leistung. Die Arbeiter bekämen demnach fast alles, der Kapitalist fast nichts, es sei denn, die Risikobereitschaft wird als gleichwertig mit der bloßen Arbeitsleistung behauptet. Eine andere Forderung beinhaltet, daß der Produktionsprozeß so gestaltet werden muß, daß nichtentfremdete Arbeit möglich ist, denn sie allein sei der Ort der Verwirklichung des Menschen.
Nach der ersten Überzeugung bekämen auch all diejenigen wenig oder nichts, die (verschuldet oder unverschuldet) weniger leisten können. Dieser Punkt trifft auf eine sozialistische wie auch auf eine kapitalistische Ordnung zu. Nach der zweiten wären alldiejenigen benachteiligt, die die organisierte Arbeit nicht als Ort ihrer Verwirklichung ansehen. Selbst wenn aber die Arbeit unter dem sozialistischen Deckmantel der befreiten Arbeit organisiert ist, könnten einige dies als Zwang und Unterdrückung empfinden. Unter den bisher erarbeiteten Gerechtigkeitsprinzipien könnte also an einem konservativen Ansatz (sozialistisch oder kapitalistisch orientiert) berechtigte Kritik geäußert werden.
Die Entfremdungsthese beinhaltet eine gewissermaßen perfektionistische Komponente, die (v.a. im konservativen Zusammenhang) zu massiven Beschränkungen der wertvollen Lebenswege führen kann. Die Überbewertung der organisierten Arbeit widerspricht aber ganz offensichtlich der Marxschen Intention von der zukünftigen Rolle der Lohnarbeit. Auflösen läßt sich das Problem z.T., wenn der Facettenreichtum des Marxschen Arbeitsbegriffs genauer betrachtet wird. Gerade was die Entfremdungsthese angeht, stützt sich Marx vorwiegend auf seine anthropologischen Ansätze und nicht auf die analytischen der späteren Kritik der politischen Ökonomie. Der Wert der nichtentfremdeten Arbeit ist in diesem Zusammenhang als Befreiung von sinnentleerter Tätigkeit zu verstehen. Marx Ableitung des Arbeitsbegriffs läßt sich anhand von 5 Schritten verdeutlichen:
1) Praxis (kommunikativ o. produktiv*) -> 2) *Beschäftigung (frei o. zielorientiert*) -> 3) *Arbeit (sinnvoll o. notwendig*) -> 4) *organisierte Arbeit (selbst- o. fremdbestimmt*) -> 5) *Lohnarbeit.
Das eigentliche Ziel der Marxschen Entfremdungtheorie ist nicht die Behauptung der herausragenden Rolle von organisierter Arbeit nach dem Leistungsprinzip, sondern die Förderung der Verrichtung notwendiger Arbeit unter der Zielsetzung der Selbstverwirklichung bei selbstbestimmter, sinnvoller Beschäftigung. Diese Interpretation könnte gerade die Befreiung von falscher Arbeit und Arbeitszwang bedeuten. Zwar ist die starke Rolle der Arbeit im menschlichen Entwicklungsprozeß auch hier noch implizit; sie ist aber viel weiter gefasst. Das "Arbeit vs. Freizeit"-Dilemma stellt sich dann auch nicht mehr in dem Maße wie es Kymlicka darstellt, auch wenn zeitweilig entfremdete Arbeit (die Marx nicht vor Augen hatte) richtigerweise auch Vorteile haben kann.
"Vielleicht ist mir nicht-entfremdete Arbeit wichtig, aber z.B. Freizeit noch wichtiger. Die produktivste Arbeitsorganisation (so die Fließbandarbeit) läßt vielleicht wenig Raum für Kreativität und Zusammenarbeit. Wenn ich in etwa 2 Stunden entfremdeter Arbeit so viel produzieren kann wie in 4 Stunden nichtentfremdeter, dann sind mir die 2 Stunden Tennis, die ich gewinnen kann, vielleicht lieber."
Die Pluralität der Lebensformen auch in einer Gesellschaftsform mit nicht-entfremdeter Arbeit beizubehalten, scheint also nicht der marxistischen Theorie überhaupt zu widersprechen.
Ungeklärt ist noch das Ausbeutungsproblem. Es müßte (um gerecht behoben zu werden) sich nicht nur auf den Produktionsprozeß unter Verwendung eines repressiven Leistungsbegriffs beziehen, sondern in ein übergreifendes Verteilungsprinzip eingebaut werden. Dort sollte geklärt werden, welche Beschneidung der Selbstbestimmung zugunsten anderer gerechtfertigt ist, auch wenn sie dem libertären Grundprinzip nach maximaler individueller Freiheit vielleicht gegenläufig ist.
Die Ausbeutung besteht auf einem formal rechtmäßigen und gleichen, aber in der Praxis ungleichen Tausch und ist mit dem Entfremdungsprozeß eng verwoben. Die Ausbeutung beruht in der klassischen Form darauf, daß dem Arbeiter sein Produkt genommen (fertiggestellt oder unfertig) und ihm dafür etwas gänzlich anderes gegeben wird, was dem Wert seiner Arbeit nicht entspricht. Letztlich hat der Kapitalist ein Interesse daran, weil er daraus Gewinn schöpft - den notwendigen Profit macht. Da er dabei im engen Sinne nichts leistet, erhält er etwas, was ihm nicht zusteht, während dem Arbeiter etwas genommen wird, was ihm nach der Formulierung des Eigentums durch rechtmäßige Aneignung vielleicht zustehen würde. Er entfremdet sich vom Produkt, von seiner Arbeit und erhält dabei ein mäßiges Äquivalent - einen (geringen) Arbeitslohn.
Selbst wenn man Marx' These, daß allein Arbeit Wert schafft, nicht vertritt und eine kritische Haltung zum Leistungsprinzip einnimmt, bleibt immer noch offen, warum gerade der Kapitalist die Verfügungsgewalt über das Arbeitsprodukt haben sollte, und wie bei gerechter Entlohnung der Kapitalist daran etwas verdienen könnte.
Ein weiterer entscheidender Punkt ist, daß die Ausbeutung deshalb vorliegt, weil keine greifbaren Alternativen für die ArbeiterInnen bestehen, dieses Arbeitsverhältnis aufzugeben. Vielleicht finden es einige ja in Ordnung, ausgebeutet zu werden. Dann müssten andere allerdings die Möglichkeit haben, wenn es ihnen nicht gefallen sollte, auszusteigen. Diese "exit option" ist in streng kapitalistisch organisierten Gesellschaften nicht gegeben. Wenn schon nicht die Produktionsmittel gleich verteilt sind, so müßten also mindestens Güter generell so verteilt werden, daß für alle die Möglichkeit besteht, selbständig oder gegen Lohn, entfremdet oder nicht-entfremdet, zu arbeiten.
Außerdem muß geklärt werden, wann Ausbeutung im Sinne der Verletzung des Selbsteigentums genau vorliegt. Nützlich wäre es dazu, zu verdeutlichen, wann produzierte Güter von ihren Produzenten abgezogen werden können, und wohin sie verteilt werden sollten. Weiter oben wurde angedeutet, daß das Arbeitsprodukt dem Kapitalisten eigentlich nicht oder nur z.T gehört, dem Arbeiter aber vielleicht auch nicht. Wie wäre zu erklären, warum der Arbeiter bei Produktion im sozialen Zusammenhang alleiniger Besitzer eines Abeitsproduktes sein soll, wenn er doch an dessen Wert nur als anonymer Träger der wertschaffenden Arbeitspraxis in Form von gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit beteiligt ist? Es scheint deshalb vertretbar, einen (kleinen) Teil der geschaffenen Werte generell an alle zu verteilen, und einen (größeren) über öffentliche Institutionen an die Bedürftigsten zu geben. Wäre es sinnvoll, auch dann von Ausbeutung zu sprechen, wenn der Arbeiter nicht den Wert seiner produktiven Arbeit erhält, aber zu gerechter Verteilung zugunsten der Behinderten oder Arbeitslosen beiträgt?
"Diese Beispiele zeigen, daß es am Grunde der Ausbeutung eine tieferliegende Ungerechtigkeit gibt: die ungleiche Verfügung über die Produktionsmittel. Entrechtete Frauen, Arbeitslose und Lohnarbeiter leiden alle unter dieser Ungerechtigkeit, und die Kapitalisten profitieren von ihr."
Ausgebeutet werden demnach alle, die unter den gegebenen Bedingungen lieber ihren gerechten Anteil an Gütern nehmen und aus der Situation aussteigen würden, um unter anderen Verhältnissen zu arbeiten. Die rein libertäre Ausbeutungskritik vergißt, daß begrenzte Abhängigkeit die eigene Produktivität steigern kann und zudem soziale Sicherheit bietet, die unter völliger individualistischer Freiheit nicht erreichbar wäre.
Diese Erkenntnis könnte eine wichtige Ergänzung zu Rawls' Forderung der ständigen Überprüfung der Verteilungssituation über seinen zweiten Gerechtigkeitsgrundsatz sein, da einige Ungleichheiten fern von reiner Einkommensverteilung und medizinischer Versorgung etc. so aufgedeckt werden könnten. Auch rückt der Marxismus die historische Entwicklung der Verteilung der Produktionsmittel und Produkte viel stärker in den Mittelpunkt. Die tatsächliche Ungleichverteilung beruht ja nicht auf einer ursprünglichen Gleichverteilung mit nachfolgender ungleicher Leistungsfähigkeit und ungleichen Präferenzen, sondern vielmehr auf einem Prozeß des Entzuges von Produktions- und Subsistenzmitteln vieler zugunsten einer Minderheit (mittels "Eroberung, Unterjochung, kurz Gewalt" - Marx). Ferner wäre also darüber nachzudenken, wie der Ausbeutung in historischer Perspektive zu begegnen ist. Wenn es ungerechte, überflüssige Ausbeutung gab, auf der noch heute wirksame Ungleichheiten beruhen, so müsste darauf in einer Gerechtigkeitstheorie geantwortet werden. Der Marxismus bietet dazu von sich aus eher Lösungen als der Liberalismus.
Eine genaue Darstellung dieses Themenkomplexes findet sich in den früheren Schriften John Roemers. In seiner Untersuchung des Ausbeutungsproblems stützt er sich auf die Veränderung der Parameter Einkommen, Freizeit und Selbstverwirklichung in unterschiedlichen Produktions/Verteilungs-Konstellationen. Einkommen wird der Freizeit vorgezogen, so daß ein Zustand mit mindestens gleicher Freizeit, aber höherem Einkommen, dem mit mehr Freizeit, aber niedrigerem Einkommen vorgezogen wird. Außerdem kann mehr Selbstbestimmung im Produktionsprozeß weniger Freizeit und niedrigeres Einkommen nicht ersetzen.
Eine kapitalistische Ausbeutung besteht nach Roemer, wenn eine Gruppe entscheidet ihren gerechten Pro-Kopf Anteil am non-humanen Eigentum in der Gesellschaft abzuziehen, um in andere (alternative) Verhältnisse zu wechseln. Sie würden dies nach dem marxistischen Ansatz tun, weil der Wert der Güter, den sie mit dem Gegenwert ihrer geleisteten Arbeit kaufen können, unter dem Wert der von ihnen produzierten Güter liegt.
Unter sozialistischer Ausbeutung werden dann Menschen leiden, wenn ungleiche Ausstattung mit Talenten und Leistungsfähigkeit vorliegt, da diese unveräußerlichen Güter nicht in einem Topf gesammelt werden können. Da die wenig Leistungsfähigen auch weniger beitragen können, werden sie aus dem gemeinsamen Topf der veräußerlichen Güter wenig bekommen (nicht viel besser sind überdurchschnittlich Leistungsfägige gestellt).
"An agent or coalition is capitalistically exploited if it can improve its income-leisure lot by withdrawing with ist per capita share of the alienable assets of society and its own inalienable assets (rather than ist own assets). A coalition is socialistically exploited if it can improve ist lot by withdrawing not only its per capita share of alienable assets, but its per capita share of inalienable assets."
Darauf allein läßt es Roemer aber nicht beruhen, da er in historischer Perspektive auch notwendige (nicht minder ungerechte) Ausbeutung ausmacht. D.h., immer wenn feststellbar ist, daß eine Ausbeutung vorherrscht, die die Entwicklung der Produktivkräfte (Bildung, technischer Fortschritt, Organisation etc.) vorantreibt, wird eine Gruppe, die wegen dieser Gründe in andere Verhältnisse wechselt, in solche wechseln müssen, die die notwendige Ausbeutung schon hinter sich haben, oder aber sie werden in ihrem Wohlstand insgesamt zurückfallen.
"If, [...] the coalition will be worse off - if not immendiately, then ‘soon’ - then I will say the capitalist exploitation which it endures is socially necessary."
Jegliche Ausbeutung, die in sozialer Hinsicht keine Vorteile bietet ist demnach auszuschalten, allein deshalb, weil sie nicht notwendig ist - das sei das spezifisch marxistische Argument.
"To summarize, the elimination of dynamically socially unnecessary exploitation is the relevant evaluative criterion, because, first, during the era of scacity, it increases the opportunities for short run self-actualization of men by providing the formerly exploited large group with access to the wherewithal for basic living [dies sehen auch die Ansätze Rawls’ (Grundgüter) und Sens (equalisation of basic capabilities) vor], and second, according to historical materialism, the elimination of socially unnecessary exploitation is necessary for the development of the produktive forces, which is the proxy for self-actualisation of man."
Roemers Ansatz läßt sich mit Richard Arnesons Ausbeutungskritik erweitern. Er hält das technische Notwendigkeitsargument für nicht stark genug und möchte es wieder normativ ausweiten, um damit Gerechtigkeitsargumente entwickeln zu können. Arneson behauptet, daß im Bezug auf moderne Gerechtigkeitsvorstellungen Marx Kritik nur dann Sinn macht, wenn man neben dem Moment der Ausbeutung im rein technischen Sinne auch das Moment des ethischen Verständnisses herausarbeitet. Arnesons Ansicht nach ist Marx' Ausbeutungsvorwurf nur dann interessant, wenn er über die rein technische Verwendung hinausgeht und zur "wrongful exploitation" übergeht, da es eine Reihe rein technischer Ausbeutungsfälle gibt, die auch im Marxschen Sinne nicht ungerecht wären. Sklavenausbeutung ist keine, die im engen Sinne auf technischer Ausbeutung beruht, da ihnen kein Surplusprodukt genommen wird (es bestehen auch nach Marx die Produktions- und Rechtsbedingungen nicht, unter denen es sinnvoll wäre von Ausbeutung der Lohnarbeit zu sprechen). Trotzdem würden wir sagen, daß Sklaven ausgebeutet werden, weil sie nicht über gleiche Rechte verfügen, keinen Zugang zur Macht haben und ihnen etwas genommen wird, worauf niemand anderes gerechterweise einen Anspruch hat.
Ein zweites Beispiel bringt eine imaginäre Gesellschaft, in der es nur arbeitsunfähige Maschinenbesitzer einerseits und arbeitsfähige Besitzlose andererseits gibt. Die internen und externen Ressourcen sind extrem ungleich verteilt und beide Gruppen würden sterben, wenn sie nicht entscheiden würden, zusammenzuarbeiten. Die Arbeitsunfähigen leihen den Arbeitsfähigen ihre Maschinen, dafür erhalten sie einen Anteil der Arbeitsprodukte. Obwohl den Arbeitenden ein Teil ihres Arbeitsprodukts genommen würde (sie also im technischen Sinne ausgebeutet werden), besteht doch kein Ausbeutungsverhältnis, daß wir als ungerecht bezeichnen würden. Ein weiteres Beispiel zeigt das gleiche Ergebnis: Auf einem Landstrich mit unterschiedlicher Qualität arbeiten zwei Gruppen gleich hart. Die Gruppe, welche auf dem qualitätiv hochwertigerem Teil arbeitet, hat eine höheren Ertrag als die andere Gruppe, gibt ihr aber der Tradition entsprechend 20% ihres Ertrages ab. Obwohl hier nach Marx Ausbeutung im technischen Sinne vorliegen könnte, ist die Lösung doch eigentlich eine gerechte. Arnesons Lösung lautet:
"[...] wrongful exploitation exists wherever technical exploitation exists together with the following two conditions: (1) the nonproducers have vastly more social power than the producers, and they employ this power to bring about technical exploitation; and (2) this technical exploitation establishes an extremely unequal distribution of economic advantages, and it is not the case that one can distinguish the gainers from the losers in terms of the greater deservingness of the former."
Reale Chancengleichheit zur Erlangung von - bzw. gleicher Zugang zu - Wohlergehen
Neben dem Versuch, eine aktualisierte Ausbeutungstheorie zu formulieren, haben sich Roemer, Cohen, Arneson und Elster auch mit der Frage "Ressourcengleichheit oder Gleichheit des Wohlergehens?" beschäftigt. Sie nehmen dabei sowohl auf Rawls und Dworkin als auch auf Sen Bezug.
Cohens Ansatz des "equal access to advantage" möchte die Idee der Verantwortlichkeit gegenüber der Entwicklung des eigenen Lebens aufrechterhalten und deshalb nicht alle selbstverschuldeten Nachteile kompensieren. Er hält Dworkins Schnitt zwischen natürlicher Ausstattung und Geschmäckern oder Präferenzen für schlecht gewählt und begründet. Wenn sich eine Gerechtigkeitstheorie (wie die Dworkins) vornimmt, "brute luck" zu kompensieren, sollten alle Wohlergehensdefizite ausgeglichen werden, die nicht auf individuelle Entscheidungen zurückgeführt werden können.
"I believe that we should compensate for disadvantage beyond a person’s control, as such, and that we should not, accordingly, draw a line between unfortunate resource endowment and unfortunate utility function. [...] There is no moral difference, from an egalitarian point of view, between a person who irresponsibly acquires [...] an expensive taste and a person who irresponsibly loses [...] a valuable resource. The right cut is between responsibility and bad luck, not between preferences and resources."
Wie auch schon Sen bemerkt hat, sind die zu verteilenden Güter ja selbst wieder nur Mittel und nicht Zweck. Cohen behauptet, Güter sicherten nicht immer den gleichen Zugang zu Wohlergehen. Und wenn denn nicht Wohlergehen das einzige Ziel sein kann, wie Sen behauptet, dann laut Cohen doch der Zugang zu Nutzen oder Vorteilen insgesamt. Letztlich bediene sich die Theorie der Ressourcengleichheit der gleichen Argumente wie die Theorie der Chancengleichheit zu Wohlergehen, so seien Dworkins Argumente umformulierbar.
"A would-be resource egalitarian who said, ‘Compensation is in order here because the man lacks the resource of being able to avoid pain’ would be invoking the idea of equality of opportunity for welfare even if he would be using resourcist language to describe it."
Cohen kommt zu dem Ergebnis, daß Ressourcen- sowie Wohlergehensdefizite gleichermaßen Kandidaten für eine Kompensation durch Umverteilung sein können. Armut, physische Schwäche, Niedergeschlagenheit, Mißerfolg beim Erreichen gesetzter Ziele seien unterschiedliche Fälle von Ressourcen- oder Wohlergehensungleichheit, die gleichwertig Ziel einer gerechten Umverteilung sein können.
Arnesons Formulierung ist etwas offener, da er nur die Chancengleichheit zum Wohlergehen fordert, nicht aber den direkten Zugang fördern und angleichen möchte. Seine Vorstellung der Chancengleichheit besagt ausformuliert folgendes:
"1. die Optionen sind äquivalent, und die Menschen verfügen über die gleiche Fähigkeit, diese Optionen ‘wahrzunehmen’; 2. die Optionen sind in der Weise nicht äquivalent, daß sie die unterschiedlichen Fähigkeiten zu ihrer Wahrnehmung genau ausgleichen; 3. die Optionen sind äquivalent, und die unterschiedlichen Fähigkeiten der Menschen, die wahrzunehmen, sind durch Gründe bedingt, für die die Individuen zu Recht selbst verantwortlich zu machen sind. Gleiche Chancen zur Erlangung von Wohlergehen sind dann gegeben, wenn alle Menschen effektiv ein äquivalentes Spektrum von Optionen haben."
Wer nicht gänzlich pauschal umverteilen möchte, weil dadurch verschuldete und unverschuldete Ungleichheiten ungerecht gleich wenig oder viel berücksichtigt werden, der/die könne, so Arneson, sowohl Chancengleicheit in bezug auf Güter als auch bezüglich Wohlergehen fordern.
Die eigentliche Schwäche in Cohens und Arnesons Theorien ist, daß auf die entscheidende Frage, nämlich wie die tatsächliche Chancengleicheit hergestellt werden soll, keine Antwort zu finden ist. Dworkin wählt ja laut eigenen Angaben nur die zweitbeste Lösung, und Rawls hat vielleicht (entgegen seinen Behauptungen) nicht die gerechteste. Aber beide sind einigermaßen konkret und schaffen einen Schritt hin zur wirklichen Chancengleicheit. Cohens und Arnesons Einwände sind zwar verständlich, aber sie gehen steng genommen nicht über Sens Ansatz hinaus und bieten keine Lösung des Problems, welches Arneson selbst zutreffend beschreibt:
"Im konkreten politischen Leben unter modernen Bedingungen werden die Verteilungsinstanzen erstaunlich wenige Fakten kennen, die eigentlich bekannt sein müßten, wenn man genau bestimmen wollte, welche Chancen zur Erlangung von Wohlergehen verschiedene Menschen gehabt haben. Bis zu einem gewissen Grad ist es technisch nicht machbar oder sogar völlig unmöglich, die benötigten Informationen zu sammeln, weil wir die Sorge haben, daß eine solche Ermächtigung mißbraucht wird.[...] Wir können darauf bestehen, daß die Regierungen darauf achten, daß die Grundgüter oder Ressourcen gleich verteilt werden, was ein ungefährer Ersatz für die Gleichheit des Wohlergehens wäre, die wir nicht messen können."
Interessant ist schließlich, daß Arneson einige Argumentationsschwächen bei Rawls und Dworkin aufdeckt, aber doch zum gleichen (praktikablen) Ergebnis gelangt. Damit kommt er in der Problemlösung nicht weiter, als hier bisher erarbeitet wurde. Andere Versuche müssten sich dem (hier weiter oben schon aufgeworfenen) Vorwurf, den er Sen und Rawls macht, ebenso stellen:
"Aber wie sollen wir die verschiedenen Fähigkeiten eines Individuums in einen umfassenden Index aufnehmen, da es doch unendlich viele Dinge gibt, die Menschen tun oder werden können? Wenn wir einen solchen Index nicht konstruieren können, so kann die Gleichheit der Fähigkeiten wohl kaum als eine Konzeption der Verteilungsgleichheit in Frage kommen. Das Problem der Indizierung, das bekanntlich Rawls’ Vorschlag bezüglich der Grundgüter belastet, trifft folglich auch auf Sens Ansatz zu."
Abschließend läßt sich feststellen, daß die Behandlung des Ausbeutungsproblems eine wichtige Ergänzung der Gerechtigkeitsfrage ist, auch wenn sie nicht eine Alternative zur Verteilungsgerechtigkeit insgesamt darstellt, sondern in sie eingearbeitet werden soll. Die Frage nach gerechten Produktionsverhältnissen in marktförmig organisierten Gesellschaften, der Umgang mit der ursprünglichen Aneignung der Produktionsmittel und der Umverteilung trotz Recht auf Selbsteigentum sowie der Wert der Selbstverwirklichung neben der Selbstachtung werden von Cohen, Roemer und Arneson eingehend behandelt. Ihre neueren Ansätze zur Frage Ressourcengleichheit vs. Wohlergehensgleichheit decken zwar einige Argumentationslücken auf, bringen jedoch keinen Fortschritt in der Frage, wie gerechte soziale Grundsicherung mit Blick auf die Kompensation von Benachteiligung genau zu organisieren ist.
1.5 Van Parijs
Van Parijs’ Modell des unconditional basic income
Philippe van Parijs geht einen anderen Weg. Anstatt zu fragen, wie die Umverteilung im einzelen zu organisieren ist, um den "wirklich" Benachteiligten einen Ausgleich zu bieten, fordert er ein einfaches Prinzip der Ressourcengleichheit, das der Grundidee Rawls’, Dworkins und Sens entsprechen, und dabei dem libertären Vorwurf der Ausbeutung der Talentierten entgehen soll. Er fordert ex ante vor aller Leistungsfähigkeit oder -willigkeit, vor jeder Bedürftigkeit und Ausstattung ein unbedingtes Grundeinkommen für alle (unconditional basic income - UBI).
"If real freedom is a matter of means, not only of rights, people‘s incomes are obviously of great importance."
Dieses UBI ist die Einkommensbasis, zu der alle weiteren (zu versteuernden) Einkommen addiert werden. Im Gegensatz zur NIT wird es irrespektiv aller Einkommen ausgezahlt. Die Einkommensgarantie vor der Steuer-/Transferprüfung könnte die NIT nur durch die Implementierung einer ex ante Pauschalauszahlung leisten.
Spätestens seit Political Liberalism gesteht Rawls ein, daß z.B. Behinderte besonders unterstützt werden müssen und daß u.a. Freizeit fast wie Einkommen zu den Grundgütern gezählt werden kann (siehe oben C 1.1).
Surfer beispielsweise, die beschließen, einen Lebensweg mit viel Raum für Selbstbestimmung, viel Freizeit aber wenig Einkommen aber einzuschlagen, müssen nach Rawls nicht damit rechnen, von der Gemeinschaft unterstützt zu werden, da sie nach einem Rawlschen Lebensstandardindex nicht zu den "worst-off" gehören. Ihre Benachteiligung etwa bezüglich Einkommen sei selbstverschuldet.
"[The extra leisure] would be stipulated as equivalent to the index of primary goods of the least advantaged. So those who surf all day off Malibu must find a way to support themselves and would not be entitled to public funds."
Van Parijs behauptet, daß dies eine unfaire Behandlung der Surfer nach Rawls' eigenen liberalen Grundsätzen sei. Deshalb will er auch diesen Personen ein Grundeinkommen garantieren. Er möchte dies begründen und die Vorteile aufzeigen.
" [...], I shall argue that a defensible liberal theory of justice, that is, one that is truly commited to an equal concern for all and to nondiscrimination among conceptions of the good life, does justify, under appropriate factual conditions, a substantial unconditional basic income. [...] It is [...] an individual garanteed minimum income without either a means test or a (willingness to) work condition. [...]
The arguments have been, to mention just a few, that a basic income would help people out of the unemployment trap, that its introduction would redistribute income quite massively from men to women, that it would improve the quality of the worst jobs, [...] and that it would enhance the flexibility of the labour market."
Grundstruktur
In van Parijs‘ Ansatz ist der Widerspruch von Freiheit und Gerechtigkeit ganz einfach aufhebbar: die gerechte Gesellschaft ist genau diejenige, die die Freiheit aller Mitglieder maximiert. Nach van Parijs muß eine solche Gesellschaft folgende drei Bedingungen in einer weichen lexiographischen Reihenfolge erfüllen:
Dieser Weg ist einer der "equality of income", antiperfektionistisch und solidarisch. Van Parijs geht es um die reale Chancengleichheit durch identische Mittel zur Unterstützung der individuellen Lebenswege. Die tatsächlichen Wohlfahrtslevel als ein Resultat der Umsetzung bereitgestellter Mittel (outcome Ansatz) ist irrelevant. Somit wird die Freizeit als Zeit des Wohlfühlens und der Freiheit von Mühe in Abweichung zu Rawls nicht berücksichtigt. Im Gegensatz zur reinen Gleichverteilung (identische Einkommen) ist das UBI nach van Parijs eine qualitative Gleichverteilung, da sie die Einkommen nur solange umverteilt, wie das Maximum an individueller Freiheit für alle gewährleistet ist. Jede Gesellschaftsordnung ist zu verändern, wenn sie gegen eine andere eintauschbar wäre, in der mindestens eine Person größere reale Chancen hätte, während alle anderen mindestens die gleichen Chancen behalten. Van Parijs zufolge muß die ideale Gesellschaft immer formale Freiheit und Gleichheit in Form von Rechten mit realer Freiheit und Chancengleichheit in Form von Mitteln verbinden. Da die Lebenspläne und die Fähigkeiten der Menschen unbekannt bleiben und nicht nach objektiven Kriterien perfektionistisch beurteilt werden, muß das UBI so hoch angesetzt werden wie möglich, um nicht eine Person gegenüber einer anderen zu diskriminieren.
"What we have to go for is the highest unconditional income for all consistent with security and self-ownership."
Auch demographische Effekte gehen in die Gestaltung des UBIs ein. Das gleiche UBI könnte bei steigender Geburtenrate nicht mehr aufrechterhalten werden. Eine Lösung wäre, das UBI mit einer Grundrente (und ohne die bisherige rente) für Alte und einem niedrigeren UBI für Kinder zu variieren. So wären die Alten unabhängig von der Unterstützung durch ihre Kinder und das Unterhalten von Kindern wäre durch eine geringere staatliche Unterstützung teurer. Wird der Anteil der RentnerInnen zu hoch, müsste ihr Vermögen und Einkommen wie das der anderen Menschen versteuert werden. Die Voraussetzungen müssen so aufrechterhalten werden, daß die nächste Generation mindestens über ein so hohes UBI verfügen kann, wie die bestehende.
Das UBI wird aus drei Quellen finanziert, die jeweils die individuelle Aneignung zuvor eigentumsloser externer Güter besteuern zugunsten derjenigen, die auf die Aneignung verzichten müssen oder wollen:
a) natürliche Ressourcen; b) Technologie und Wissen; c) Arbeitsplätze
Die Konsistenzprüfung und die Forderung nach Aufrechterhaltbarkeit des UBI kann zu einem großen Volumen desselben führen, aber auch dazu, daß es sehr gering ausfällt, ja nicht einmal die Höhe des Existenzminimums erreicht. Da das UBI ein Grundrecht ist, welches sich nicht nach dem Bedarf richtet, ist diese Tatsache auf einer abstrakten Ebene nicht problematisch. In realen Gesellschaften könnte dies aber zur Bevorzugung eines anderen Sicherungssystems führen.
"Indeed, as long as the unconditional inome does not cover what they regard as basic needs, most of its proponents would not want to eliminate even the existing conditional minimum income schemes."
Ein weiterer Punkt ist die Berücksichtigung interner Ressourcen. Van Parijs macht ein gewisses Eingeständnis an die ResultatstheoretikerInnen, indem er die reale Chancengleichheit durch eine akzeptable Gleichheit in der Vielfalt gewinnen will. Im Gegensatz zur ganzen Resultatsgleichheit oder dem Neidfreiheitskonzept Dworkins, führt er eine schwache Variante ein, die er "undominated diversitiy" (vorherrschaftsfreie Verschiedenheit — D.E.) nennt. Van Parijs muß berücksichtigen, daß reale Freiheit ein Resultat individueller Ausstattung, formaler Freiheiten und der Bereitstellung von Mitteln ist. Aufgrund dessen dürfen Personen mit schlechterer interner Ausstattung nicht gegenüber anderen diskriminiert werden. Ihr Lebensweg zählt gleich, und sie müssen die gleichen realen Chancen haben wie alle anderen. Das Prinzip der "undominated diversity" ("potential envy-freeness") ist nur dann erfüllt, wenn keine Gesamtausstattung einer Person, bestehend aus vergleichbaren Merkmalen interner Ausstattung plus dem UBI und eventueller Pauschalbeträge, von allen als besser als irgendeine Gesamtausstattung einer anderen Person angesehen wird. Diese Regelung fordert also nicht wie Dworkin eine faktische Neidfreiheit (diese ist laut van Parijs nicht erreichbar), sondern beruht auf einer Beurteilung Dritter, die die nichtkonsensfähigen Ansprüche unberücksichtigt läßt.
Normale Personen sind in den Augen aller selten ungleich ausgestattet, während die behinderte Person mit Sicherheit von allen als schlechter gestellt angesehen wird, als mindestens eine normale Person. Die offensichtlich stark Benachteiligten hätten so die Garantie der Zusatzzuwendungen.
Die Berücksichtigung all dieser Voraussetzungen führt van Parijs zu dem Ergebnis, daß ein wirkungsvolles UBI nur in relativ reichen (Industrie-)Gesellschaften durchsetzbar ist. Das UBI sollte in diesen Gesellschaften nur so hoch sein, daß es auch für die nächsten Jahre und die kommenden Generationen finanzierbar bleibt.
Es wäre auch zu überlegen, ob nicht ein Teil des zu verteilenden Volumens unaufgeteilt und in ständigem Gemeineigentum verbleiben sollte. Auch diese Überlegung könnte das UBI senken. Welche Wirtschaftsform genau zur Finanzierung des UBIs gewählt werden sollte, ist nicht von vornherein klar. Van Parijs hält eine "mixed economy" (weder reines Gemeineigentum der Produktionsmittel, noch reines Privateigentum) als Grundlage einer UBI-Gesellschaft für naheliegend. Er läßt es offen, ob die ideale Gesellschaft innerhalb dieser Grauzone zur Finazierung eines effektiv maximalen UBIs eher zum Sozialismus oder eher zum Kapitalismus tendiert. In Basic Income Capitalism bietet er viele Argumente gegen die Ablehnung einer sozialistischen Ordnung (477 ff), während er in Real Freedom for All eher zum Kapitalismus tendiert (54 ff u. 191 ff).
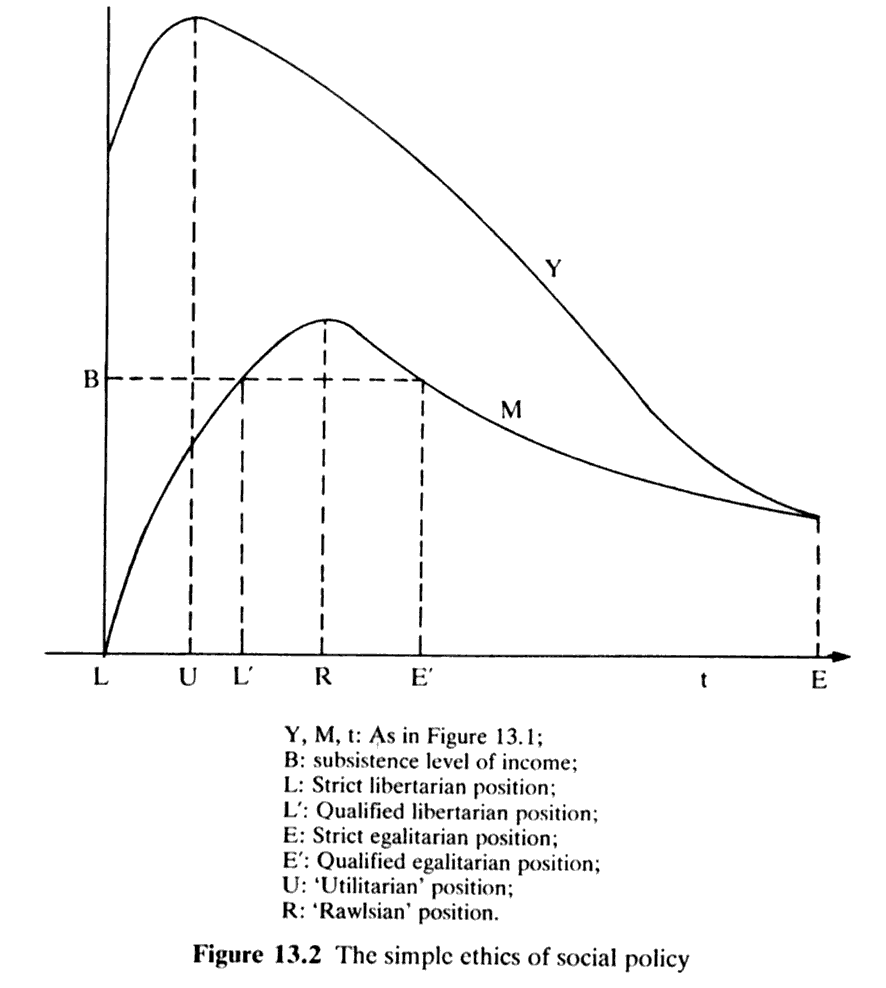 Schaubild 9
Schaubild 9
Verteidigung
Dieses Gesamtkonzept hält er auch gegen Rawls und Dworkin für vertretbar.
"For this reason, the granting of a substantial basic income is more germane to the access to ‚active‘ property associated with Rawls’s ideal of a ‚property-owning democracy‘ than to the ex post corrective redistribution which he views as characteristic of the welfare state."
In der ‚Rawls-Sen-van Parijs Formulierung‘ des Differenzprinzips sollte die tatsächliche Freiheit derjenigen maximiert werden, die am schlechtesten dastehen, solange dabei für alle anderen noch irgendein Vorteil erkennbar ist und das Verteilungsverhältnis nicht insgesamt umgekehrt wird. In der van Parijsschen Interpretation begründet das Differenzprinzip genau die Einführung eines UBIs auf dem höchsten erhaltbaren Level.
"For the Difference Principle is a maximin criterion, and the level of the basic income determines the bundle of socioeconomic advantages available to the worst-off, to those who have nothing but that basic income."
Dieser Standpunkt des "real libertarianism" (van Parijs' Ansatz) würde verlangen, daß im Falle zweier Gleichtalentierter (einer ist ‚Workaholic‘, die andere ist ein ‚faules Stück‘) das hohe Einkommen des Workaholic nur solange zugelassen wird, wie es das UBI des ‚faulen Stücks‘ maximiert. Ansonsten würde einfach gleich verteilt. Andererseits könnte dies aber die Ausbeutung des zufällig mit der Präferenz der Arbeitswut ausgestatteten bedeuten. Wenn beide gleich talentiert sind und kein Lebensweg diskriminiert werden soll und beide ein Maximum an Freiheit genießen sollen, kann das UBI dann nicht auch bei 0 liegen? Im einen Fall wäre das ‚faule Stück‘ am besten gestellt, im anderen der Workaholic.
"So does it turn out that between the maximum feasible level of the grant and no grant ar all, the real-libertarian approach is unable to select a nonarbitrary ‘neutral’ point which would not discriminate against either Crazy or Lazy?"
Jedesmal wären die Prinzipien der "undominated diversity" und des "self-ownership" nicht erfüllt. Van Parijs behauptet eine Lösung anbieten zu können:
Nach Rawls' neueren Formulierungen müßte das UBI bei 0 liegen, da Freizeit zu den Grundgüter zählt. Der Freizeitindex berechnet sich nach Rawls durch einen 24 Stunden Tag abzüglich der Standardarbeitszeit. Nach van Parijs ist die Formel w + ((n-m)/n) x g £ w nur dann erfüllt, wenn g = 0. Je weniger Lazy arbeitet, desto höher liegt das Einkommen mit UBI über dem Nettoarbeitseinkommen. D.h., daß alle anderen Fälle das Verhältnis umkehren (das Differenzprinzip wird verletzt), sobald Freizeit als ein eigenes Grundgut dem Einkommen gleichgestellt wird (wenn angenommen wird, daß Lazy nie gleich oder mehr arbeitet als Crazy). Hier ist die Freizeit der ausschlaggebende Faktor für die Nichterfüllung der o.g. Prinzipien.
Der erste Einwand van Parijs‘ bezieht sich auf die dieser Auflösung immanenten Trennung von Arbeit und Freizeit (denn nur so funktioniert die Formel). Erstens sei nicht klar, welche Tätigkeiten überhaupt zum Arbeitsbegriff gehören, und zweitens sei in der reinen Arbeitszeit so der Leistungsbegriff nicht wirklich verkörpert, da die Standardarbeitszeit nicht zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit unterscheide. Hinzu komme noch, daß Personen Anspruch auf einen Teil des Arbeitseinkommens anderer erheben könnten, weil sie gar nicht freiwillig ihr Leben in Freizeit verbringen, sondern vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen seien. Van Parijs hält die Behauptung für unhaltbar, daß Freizeit gleichzusetzen sei mit dem Einkommen, das über Erwerbsarbeit erzielt werden könne, da das Einkommen den Rahmen für wirkliche Freiheit setze, den die fomale Freiheit in Form von Freizeit nicht garantieren könne. Die Rawlssche Formel kann also nicht maximale wirkliche Freiheit für den ‚Workaholic‘ und das ‚faule Stück‘ gleichermaßen garantieren.
Dworkins Theorie der Ressourcengleichheit vor dem Konkurrenzmarkt folgend sieht die Lösung anders aus. Angenommen die externen Ressourcen auf deren Basis die Arbeit stattfindet, werden auf Crazy und Lazy gleichverteilt. Lazy hat aber kein Interesse, die Ressource (beispielsweise Ackerland) als Grundlage ihrer Arbeit zu nutzen, dann wird sie sie vielleicht an Crazy verpachten, der wegen seiner Neigung gar nicht genug vom Arbeiten bekommen kann und so mehr Land braucht. Die Beiden werden sich nach Dworkin genau dort einigen, wo keiner die Situation der anderen beneidet. Übertragen auf komplexere Gesellschaften würden die externen Ressourcen auch Produktionsmittel und Technologie im allgemeinen sowie Wissen beinhalten. Werden diese Ressourcen nicht gleichmäßig verteilt, so bekommen alle die diese Ressourcen nicht Nutzen können oder wollen, ihren Anteil in Form des UBIs ausgezahlt, das nur so hoch liegt, daß alle NutzerInnen der externen Ressourcen die anderen nicht um ihre Situation beneiden.
"Thus, in our society of Crazies and Lazies, the legitimate level of basic income is just the endogenously determined value of their equal tradable right to land. [...]
And it is only then that a basic income pitched at the highest sustainable level that can be financed out of gifts and bequests can claim to provide maximin real freedom."
In der Gleichverteilung der natürlichen und gesellschaftlich geschaffenen externen Ressourcen liegen die ersten beiden Quellen für die Finanzierung des UBIs.
Obwohl alle (auch die Arbeitenden) dieses UBI bekommen würden, sei die Akzeptanz nur dann gewährleistet, wenn es den Ursprungswert der Ressourcen nicht erreicht. Der Gewinn aus der Pacht könnte voraussichtlich kein ausreichend hohes Grundeinkommen finanzieren. Zusätzlich befinden sich schon einige externe Ressourcen (notwendiger - oder sinvollerweise) in Gemeineigentum oder können gar nicht als Eigentum formuliert werden. Wie könnte aber ein höheres Grundeinkommen begründet werden? Selbst wenn Wissen und Technologie als Gemeingut z.T. miteinbezogen werden, nimmt der Gesamtumfang des UBIs nicht wesentlich zu.
Bisher wurde allerdings außer acht gelassen, daß die moderne Industriegesellschaft (auf die das Gerechtigkeitsmodell angewandt werden soll) nicht aus vielen unabhängigen ProduktionsmittelbesitzerInnen besteht, sondern im Wesentlichen eine Gesellschaft der Lohnarbeit ist. Diese Gesellschaft ist stark durch diese Tatsache geprägt und die Teilnahme am Arbeitsmarkt ist ein entscheidender Faktor für den sozialen Status der Einzelnen und für ausreichendes Einkommen. In dieser Gesellschaft ist (ausreichend bezahlte) Erwerbsarbeit knapp, und so kann sie als Gut überhaupt bezeichnet werden. Es ist eine Tatsache, daß selbst wenn alle potenziellen Arbeitnehmer gleich talentiert und gleich arbeitswillig wären, sie niemals alle den Arbeitsplatz bekommen könnten, den sie im Idealfalle bekämen. Oft bekommen sie sogar gar keinen. Dieses Ungleichgewicht kann wegen mangelhafter Organisation des Arbeitsmarktes, wegen Gewerkschafts- oder Unternehmermacht oder wegen notwendigen Mindestlohnregelungen bloß kurzzeitig bestehen. Es kann aber auch chronisch werden, so daß viele auf Dauer eines Gutes beraubt werden, auf das sie wie alle anderen ein Recht haben. "Job lovers" dürfen nicht gegenüber "leisure lovers" bevorzugt werden.
Je rarer gute Jobs sind, je höher ist ihr Wert. Je höher die Arbeitslosigkeit ist, desto höher wird auch das UBI ausfallen. Die Höhe der Einzahlung durch Pachtbeträge in den Topf, aus dem das UBI finanziert wird, läßt sich ziemlich genau bestimmen:
"These rents are given by the difference between the income (and other advantages) the employed derive from their jobs, and the (lower) income they would need to get if the market were to clear. In a situation of persistent massive unemployment, there is no doubt that the sum total of these rents would greatly swell the amount available for financing the grant."
"We thus end up with a far higher basic income than seemed possible under the Dworkinian criterion."
"What we end up with is rather a basic income at the highest level that can be sustainably financed by taxing all forms of income in predictable fashion, possibly at highly differentiated rates."
Im ausgeweiteten Sinne wird aber von der arbeitenden Bevölkerung nicht nur in den Fond gezahlt, wenn es Arbeitslosigkeit gibt, sondern auch dann, wenn es statistisch gesehen keine gibt, aber das Prinzip der "undominated diversity" bezüglich der Arbeit-Einkommen Konstellation nicht erfüllt ist.
Als wichtige Nebeneffekte beschreibt van Parijs, daß es allen unter einem hohen UBI leichter möglich ist, selbständig zu werden oder Billigjobs freiwillig anzunehmen, wenn sie, abseits der geringen Bezahlung, ideelle Qualitäten zu bieten haben. Die Finanzierung aus den beiden ersten Quellen sowie den wertschöpfenden Arbeitsplätzen sollte über Einkommens-, Vermögens-, Erbschafts-, Schenkungs-, Umsatz- und Reingewinnsteuer bei natürlichen Personen und Unternehmen in reichen Gesellschaften ein UBI garantieren, das reale Chancengleichheit ohne Diskriminierung mit einfachen Mitteln in demokratischen Gesellschaften verankert. Damit wäre zumindest die Frage der Einkommensgleichheit z.T. geklärt. Bestehende soziale Sicherungssysteme könnten abgelöst werden.
Die Einführung eines solchen Modells müßte generell unter Überarbeitung des Sozialkontrakts geschehen, eine Aufgabe, die er unter der Anpassung an die neuen technologischen Herausforderung ohnehin für unvermeidlich hält. So wäre auch ein UBI zu halten, das ohne untragbare Steuererhöhungen finanzierbar wäre.
In reichen Gesellschaften ist nach van Parijs ein UBI möglich und notwendig. Es widerspricht nicht dem Ausbeutungsvorwurf, maximiert die Freiheit in einem gleichberechtigenden Sinne, realisiert Dworkins Ressourcengleichheit, bietet Grundgüter transformiert in ein Mindesteinkommen und wertet die Arbeitslosen, die ungelernten Arbeiter, die Mütter, die ausgeschlossene Jugend und die Surfer Malibus auf.
1.6 Einwände gegen van Parijs
1. Das Recht auf Arbeit und die Bedingungen für ein Grundeinkommen
Viele Einwände gegen van Parijs bewegen sich auf der Diskussionsgrundlage "Recht auf Arbeit oder Grundeinkommen?", die ihren Ursprung auch schon in den 80er Jahren hat. Besonders deutlich favorisiert Angelika Krebs das Recht auf Arbeit gegenüber einem UBI. Erst in neueren Schriften gibt Krebs die Pflicht zur Arbeit auf (außer für Notsituationen) und möchte neben dem Recht auf Arbeit ein Recht auf ein menschenwürdiges Lebens garantieren, welches u.a. auch ein (niedriges) UBI beinhaltet.
Ihre Begründung des Rechts auf Arbeit stützt sich entgegen den vier (von ihr z.T. früher auch vertretenen) verworfenen Varianten (Erfüllung durch Arbeit, zeitstrukturierende Funktion der Arbeit, soziale Kontakte durch Arbeit, Existenzsicherung durch Arbeit) auf eine kulturabhängige Begründung. Ein Recht auf Arbeit ist demnach für Krebs solange unabdingbar, wie soziale Anerkennung faktisch wesentlich über Arbeit funktioniert. Und dies gelte für "Arbeitsgesellschaften", wie die Bundesrepublik eine sei. Sie formuliert deshalb ein "Menschenrecht für Arbeitsgesellschaften in Form eines Rechts auf Arbeit und Anerkennung von Arbeit." Die Qualitäten der vier anderen Varianten seien nicht eng genug mit der gesellschaftlichen Arbeit verknüpft. Sie werden auch in anderen Formen sozialer und individueller Praxis geboten.
Trotz dieser relativierenden Formulierung bleibt das Recht auf Arbeit noch immer schlecht begründbar (neben der grundsätzlichen Frage, ob ein solchermaßen relatives Recht überhaupt ein "Menschenrecht" ist).
Will Krebs an den bestehenden Verhältnissen nichts ändern, muß sie in Kauf nehmen, daß a) Berufe bestehen bleiben, die entwürdigend sind und dem Recht auf Selbstentfaltung widersprechen und b) das dann formal bestehende Recht nicht für alle Wirkung zeigt. Verändert sie bestehende Verhältnisse, so könnte sie zwar bisher unbezahlte Arbeit bezahlbar machen, müßte aber zugleich Arbeit umverteilen, um sie für alle zu garantieren (‚Drecksarbeit‘ allen aufbrummen und die guten Arbeitsplätze allen zuteilen). Wenn es eine Pflicht zur Arbeit gäbe, wäre ein Recht auf Arbeit eine notwendige Zusatzbedingung. Da aber diese Pflicht für Wohlstandsgesellschaften nicht haltbar ist, dreht sich Krebs im Kreis und kommt nicht über ihre ursprünglichen Rechtfertigungsversuche hinaus.
Für André Gorz klingt das Recht auf Einkommen ohne Arbeitsleistung einleuchtend, nicht aber die Forderung des UBIs zuungunsten des Rechts auf Arbeit. Recht auf Arbeit heißt für ihn nicht, Recht auf Vollzeitbeschäftigung, dafür aber Recht auf Partizipation. Gorz möchte das Grundeinkommen mit dem Recht auf Arbeit verbinden und fordert für den Erhalt eines Mindesteinkommens die Leistung von 20000 Stunden Arbeit pro Leben für die Gesellschaft. Die Gesellschaft garantiert das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit im Verbund mit dem Grundeinkommen. Die Individuen erwerben dieses Recht mit der Erfüllung ihrer Pflichten der Gesellschaft gegenüber. Diese Regelung garantiere das Überleben der Gesellschaft, die Teilhabe aller am Produktionsprozeß, die Befreiung von der Alternative Vollzeitbeschäftigung oder Einkommensarmut durch niedrigen Transferbezug, biete lebenslange Fortbildungschancen und die Zeit für sinnvolle, erfüllende Beschäftigung. Die Vertreter des UBIs überschätzten zudem, so Gorz, die Integrationsleistung durch Minimierung der Stigmatisierung, die ein UBI brächte. Weder bezüglich der "microsocial communities" noch der "macrosocial communities" leiste das UBI aktive Integration. Da allerdings Gorz die erfüllende, autonome Tätigkeit nicht in der gesellschaftlichen Arbeit sieht, sondern ganz im Gegenteil nur dort, wo sie nicht-kommerziell bleibt, kann er das Recht auf Arbeit nur mit der Pflicht zur Arbeit nach einem gesellschaftserhaltenden Minimum begründen. So bleibt das Recht auf Arbeit ein Zugeständnis an all diejenigen, die von der Gesellschaft mit einer Mindestarbeitspflicht belastet werden, da das Mindesteinkommen auch unbedingt ausgezahlt werden könnte, also nicht notwendig an Arbeitseinkommen gebunden sein muß. Es bleibt fraglich, ob in einer Gorzschen Arbeitspflicht-Arbeitsrechtgesellschaft "die Lohnarbeit zu einer nebensächlichen Tätigkeit" werden könnte. Lohnarbeitszwänge könnten zwar insgesamt auch mit Gorz Ansatz abgemildert werden, viel besser aber mit einem UBI, das Gorz nur mit der Angst vor der Reproduktionsunfähigkeit abwehren kann. Zwar bleiben diese Argumente Gorz' zu berücksichtigen, es muß hier aber darauf hingewiesen werden, daß Gorz selbst vor kurzem eine starke theoretische Wendung vollzogen hat. In seinem neusten Buch vertritt auch er das UBI, gegen das er jahrzehntelang argumentierte.
"Ich habe die Forderung eines bedingungslos gesicherten Grundeinkommens lange abgelehnt [...], weil ich Arbeit als eine für alle Gesellschaften geltende ökonomische Notwendigkeit ansah, [...]. Dieses Modell leitete zwar den Ausstieg aus der Arbeitsgesellschaft und die Aufhebung der Lohnarbeit in die Wege, blieb aber in der Logik einer fordistisch-industrialistischen Arbeitsteilung gefangen. [...] Deshalb und aus vier weiteren [...] besprochenen Gründen gebe ich zugunsten der Forderung eines bedingungslos garantierten Grundeinkommens auf."
"Ein bedingungslos garantiertes Grundeinkommen für alle ist die erste Voraussetzung für eine Multiaktivitätsgesellschaft."
Für den Eigenwert (und gegen die Kompensierbarkeit) der Arbeit spricht sich Ulrich Steinvorth aus. Seine Begründung der Notwendigkeit von Kooperation in Form von Arbeit schließt die alleinige Schaffung von gesellschaftlichem Reichtum sowie die notwendige Verrichtung anfallender Arbeit ein. Das Recht auf Arbeit und eine gewisse Pflicht zur Arbeit durch die gesellschaftliche Notwendigkeit von Arbeit scheint so haltbar zu sein. Allerdings trennt auch er sinnvolle Beschäftigung ungenügend von notwendiger Arbeit. Weiterhin sagt die Abhängigkeit des gesellschaftlichen Reichtums von der Arbeit noch nichts darüber aus, mit welcher Arbeitsplatzdichte die höchste Produktivität bezüglich des erreichbaren Reichtums geschaffen werden kann. Seine Lösung für die garantierte Verrichtung notwendiger Arbeit bei gleichzeitiger minimaler Arbeitslosigkeit ist altbacken: er fordert Sozialdienste für die Arbeitslosen. Neben der Kritik der Arbeiten zweiter Klasse müßte, wenn dadurch Arbeitslosigkeit überhaupt in relevantem Maße gesenkt werden könnte, der Staat massiv als Arbeitgeber auftreten, was sich als finanzielle Belastung für die öffentlichen Haushalte herausstellen könnte.
Für ein bedingtes Grundeinkommen ("participation income") spricht sich A.B. Atkinson aus. Er allerdings möchte die Auszahlung nur von generellen Mitarbeit an gesellschaftlichen Tätigkeiten abhängig machen. Er findet ein participation income gerade deshalb interessant, weil es auf Bedarfstests (was und wieviel braucht Person x um einen Mindeststandard an Wohlergehen zu erlangen?) verzichten kann. Nach Atkinson blockiert der "means-test" persönlichen Erfolg, benachteiligt Erziehungsarbeit leistende Partner von Arbeitslosen, übergeht Anspruchsberechtigte ("incomplete take-up"), leidet unter ständigem Informationsdefizit, fördert bestimmte Lebensformen und arbeitet so gegen Unabhängigkeit. Atkinson möchte allen ein participation income auszahlen, die ein Minimum an sozialem Beitrag leisten. Für alle Volljährigen heißt das aber genauer, daß sie das Grundeinkommen nur bekommen, wenn sie a) selbständiger oder unselbständiger Arbeit nachgehen, oder b) wegen Invalidität oder Krankheit nicht arbeiten können, oder c) in Rente sind, oder d) Erziehungsarbeit leisten.
Arneson sieht keine Anhaltspunkte dafür, daß ein UBI einem bedingten Grundeinkommen generell vorzuziehen ist. Selbst wenn ressourcenorientiert und nicht wohlergehensorientiert argumentiert werde, sei nicht klar, ob nicht eher ein bedingtes Grundeinkommen ceteris paribus höher ausfallen oder ein größeres Warenangebot garantieren könnte, so daß, je nachdem wie die Freiheit gemessen wird, die Freiheit nicht über ein UBI, sondern über ein "conditional basic income" maximiert würde.
An Stelle eines UBIs hält er eine einmalige Auszahlung bei Volljährigkeit für leichter realisierbar.
Der Widerspruch zwischen dem Recht auf Grundeinkommen und dem Recht auf Arbeit ist ein Scheinwiderspruch, da das Recht auf Grundeinkommen das Recht auf Arbeit in einem schwachen Sinne verwirklichen hilft. Wer frei von Einkommenszwang der Arbeit in einem gänzlich liberalisierten Arbeitsmarkt gegenübertritt, wird sich leichter für als auch gegen eine Erwerbsarbeit entscheiden können. Das UBI ist folglich die Grundlage der realen Chancengleichheit zur Arbeit. Was van Parijs allerdings vernachlässigt, ist, daß sich für einen Job zu entscheiden nicht dasselbe ist, wie sich für den Eintritt in einen Fußballverein zu entscheiden. Auch Fußballvereine sind gut für "soccer lovers" und haben eine sozialisierende Funktion. Die gesellschaftlich notwendigen Arbeiten sind aber mit den gängigen Arbeitsplätzen viel enger verknüpft als mit allen anderen organisierten Orten sozialer Gemeinschaftshandlung. Diesen Punkt unterschätzt van Parijs.
2. Das "Aristotelische" Grundeinkommensargument
Gegen van Parijs' Begründung des Grundeinkommens wendet sich Krebs in dreierlei Hinsicht:
Krebs sieht die einzig sinnvolle Begründung letzlich nur in der Garantie eines menschenwürdigen Lebens für alle, die u.a. in einem UBI ausgedrückt werden könnte. Ihre Einwände gegen van Parijs bleiben aber auch hier schwach. Wer nicht ein gewisses Maß an Gleichheit fordert, muß zunächst begründen, warum er/sie an den bestehenden Verteilungsverhältnissen überhaupt etwas ändern will (a). Das Recht auf Arbeit (wie oben begründet) bietet kaum genuine Vorteile gegenüber einem UBI (b). Das UBI soll laut van Parijs individuelle Freiheit und Unabhängigkeit stärken. Erreicht das UBI allein dies nicht, müßte in einer UBI-Gesellschaft an der Rollenverteilung eben etwas geändert werden, wie in allen anderen auch; dies ist aber keine spezieller Einwand gegen das UBI (c).
Heiner Michel behauptet, mit van Parijs‘ Besitzindividualismus lasse sich eine Garantie des gedeihlichen Lebens für einen jeden nicht verwirklichen und fordert etwa zum Schutz des menschenwürdigen Lebens "besondere institutionelle Vorkehrungen" ein, ohne sie genauer zu benennen. Er folgert, daß der Aristotelische Ansatz, der ein Schutz des menschenwürdigen Lebens qua Menschsein und nicht per Einkommen sichern will, tatsächliche Garantien böte, die van Parijs nicht anbieten kann.
Der Aristotelische Ansatz widerspricht van Parijs allerdings überhaupt nicht, da das UBI keine Alternative zu gesellschaftlichen Grundrechten und Grundfreiheiten ist, sondern ein Teil davon. Die Aristotelischen Prinzipien sind ja bloß formale Garantien, die zwar einen anderen Maßstab benutzen, dafür aber ohne Umsetzungsverfahren reine Theorie bleiben. Die VertreterInnen des "Aristotelischen Arguments" versuchen ‚Äpfel mit Birnen zu vergleichen‘ und bieten so keine Alternative zum egalitären Grundeinkommensargument. Sie behaupten, Gleichheit impliziere keine Gerechtigkeitsqualitäten. Egalitäre Ansätze seien schon deshalb fragwürdig, weil sie sich auf ein Prinzip stützen, das quantitative Gütergleichheit für alle fordere, irrespektive der individuellen Bedürfnisse. Dafür gebe es weder gute Gründe noch sei dies zweckmäßig. Dieser Behauptung liegen Mißverständnisse und falsche Schlußfolgerungen zugrunde.
Keine aktuell vertretbare egalitäre Theorie fordert quantitative Gleichheit. Die diskutierten Varianten (auch die von van Parijs) sind qualitative Gleichheitstheorien. Überzeugende egalitäre Ansätze orientieren sich an zwei Zielen: erstens Gleichheitsprinzipien zur zweckmäßigen Verteilung der Güter zu entwickeln, um allen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen; zweitens Gleichheitsprinzipien zu entwickeln, die Menschen formal (a priori) als Menschen, als StaatsbürgerInnen, als Gleiche behandeln und gleich behandeln.
Ein nonegalitärer Ansatz müßte strenggenommen nach dem Prinzip der Ungleichbehandlung verfahren. Das hieße entweder, daß alle Verteilungsverfahren gerecht sind, die nicht gleich verteilen. Oder, daß allein das Verteilungsverfahren gerecht ist, das so ungleich wie möglich verteilt. Dies ist weder intuitiv nachvollziehbar, noch an sich ein qualitativeres Gerechtigkeitsprinzip als das egalitäre. Dieser Vergleich abstrakter Prinzipien führt also nicht zum nonegalitären Prinzip. Unvergleichbare Prinzipien miteinander zu vergleichen auch nicht, da das "Aristotelische Prinzip" Menschen als Menschen zu behandeln auf einer anderen Ebene als ‚egalitär oder nonegalitär‘ funktioniert. Allerdings beinhaltet das "als Menschen behandeln" eine egalitäre Komponente, widerspricht also dem van Parijsschen Ansatz nicht. Als Menschen sehen heißt alle gleich zu sehen, die Unterschiede zu vernachlässigen. Das "Aristotelische Argument" ist weder ein nonegalitäres, noch bietet es Argumente gegen ein egalitäres Gerechtigkeitsprinzip. Es läßt sich somit unproblematisch in eine van Parijssche Argumentation einbinden.
Man könnte van Parijs lediglich vorwerfen, daß, wenn er wirkliche Freiheit und Grundrechte garantieren will, er einen gewissen Paternalismus zulassen muß, um monetär nicht vermittelbare Güter für alle garantieren zu können. Das würde bedeuten, daß sein libertärer Ansatz allein nicht reicht, um "real freedom for all" herzuleiten.
3. Das Ausbeutungsproblem, Paternalismus und Libertarismus
In seinem Beitrag Is Socialism Dead? A Comment on Market Socialism and Basic Income Capitalism merkt Arneson an, daß er zwar Roemers und van Parijs' Grundintuitionen teilt, aber weder Roemers Idee des Marktsozialismus, noch van Parijs’ Konzept des UBI als tragbare politische Umsetzungen des Liberalismus ansieht.
Der erste Einwand gegen van Parijs besteht in seiner zu offenen Formulierung des "real libertarianism". Nach Arneson ist van Parijs’ Idee, mit dem UBI der Tendenz libertärer Gesellschaftsorganisationen bestimmte Lebensstile implizit oder explizit zu fördern (insbesondere die Pro-Arbeit Einstellungen), entgegenzuwirken. Das sei aber eine schwache Lösung des Ausbeutungsproblems und der Idee der Ausweitung der demokratischen Rechte auf den Produktionsbereich.
"The fact that someone exercises a voluntary choice among options does not guarantee that the options were fairly structured."
Stuart White wendet ein, daß es van Parijs nicht gelungen sei, dem libertären Ausbeutungsargument zu entgehen, das besagt, daß Umverteilung dann nicht stattfinden darf, wenn dadurch das Recht auf Selbstbestimmung verletzt wird. Da nach White durch das UBI Trittbrettfahrer durch die Arbeitsleistung anderer gefördert werden, sei das UBI ein Konzept, das auf Ausbeutung beruhe.
Ein UBI, das hoch genug ist, um Grundbedürfnisse zu decken, muß (wie weiter oben beschrieben) knappe Arbeitsplätze als externe Werte mit einbeziehen. Genau da setzt Whites Kritik an. Nur wer Arbeitsbereitschaft zeige oder im Arbeitsverhältnis stehe, habe ein Recht auf den Wohlstand, der über die gesellschaftliche Arbeit geschaffen werde. Van Parijs' Argumentation gelingt nach White nur mit der Einschränkung auf die Teilhabe an den Gütern, die gemeinschaftlich produziert werden müssen und eine Aktivität voraussetzen, also nicht per se bestehen. Wer nicht grundsätzlich bereit sei, der Gemeinschaft etwas zu geben, solle auch nicht das Recht haben, von ihr etwas zu erhalten. Diese Bedingung stützt sich nach White auf das Gerechtigkeitsprinzip der Gegenseitigkeit, das van Parijs vernachlässigt. Ein Grundeinkommen sei überhaupt nur dann nötig, wenn es arbeitsunfähige Menschen oder zu wenige Arbeitsplätze gebe; es sei deshalb kein unbedingtes Gerechtigkeitsprinzip. Die Arbeitswilligkeit solle sich in der Mühe ausdrücken, irgendeinen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten. Neben irgendeiner Form von Arbeitswilligkeitsprüfung fordert White die Orientierung an Bedürftigkeit, um Wohlergehensniveaus anzugleichen ("means-test").
Whites Argumentationskraft steht und fällt mit der Stärke des Gegenseitigkeitsprinzips. Es bestehen einige Einwände sowohl gegen die Überzeugungskraft, als auch gegen die Umsetzbarkeit. 1. White schreibt den Arbeitsunwilligen Instrumentalisierung ihrer Mitmenschen im Kantschen Sinne zu; dieses Argument ist aber schwach. Der Konkurrenzmarkt, den alle liberale Gerechtigkeitstheorien befürworten, akzeptiert Instrumentalisierung zu Profitgenerierung. Der zu verteilende Reichtum beruht somit immer z.T. auf instrumentalisierenden Praktiken. 2. Der Test der Arbeitswilligkeit ist mit einer Reihe von Problemen behaftet: a) die Zumutbarkeit ist objektiv nicht beurteilbar, kontextabhängig und machtgeladen, b) die innere Einstellung "arbeitswillig" läßt sich nicht direkt prüfen, damit ist eine Täuschung nie ausgeschlossen c) soziale Rechte wie das Recht auf ein Leben in Menschenwürde sind bedingungslos, es läßt sich dafür kein legitimer Arbeitszwang heranziehen. 3. White erklärt nicht, was es heißen soll, seinen Beitrag zu leisten. Er hat damit erhebliche Abgrenzungsprobleme bezüglich der Nützlichkeit von Handlungen in oder außerhalb der gesellschaftlichen Arbeit. Diese Unklarheit läßt eine Variante zu, die van Parijs entgegen kommt, aber das Prinzip der Gegenseitigkeit beinhaltet:
Der geringste leistbare Beitrag, der zudem mit keiner notwendigen Prüfung verbunden ist, ist der, durch Arbeitsplatzverzicht die Chancen auf einen guten Arbeitsplatz für die anderen zu erhöhen. Somit nehmen "Kooperationsunwillige" aktiv an der Förderung der Verwirklichung unterschiedlicher Lebensstile teil; damit sind sie berechtigt, ein Grundeinkommen zu erhalten. Diese schwache Kooperationsvorstellung kann solange vertreten werden, wie White keinen engeren Kooperationsbegriff einführt und begründet.
4.Unconditional Basic Incom vs. Unconditional Basic Outcome
Andere Autoren versuchen, die Unzulänglichkeit des UBIs hinsichtlich der individuellen Bedürfnisbefriedigung nachzuweisen. Dahinter verbirgt sich die allgemeine income vs. outcome Debatte. Während unqualifizierter Egalitarismus oder Nonegalitarismus und die Frage nach Wohlergehen oder Ausstattung mit vielen Definitionsproblemen behaftet ist, bleibt die income vs. outcome Auseinandersetzung recht deutlich. In ihr zählt allein, ob und wie man eine income oder outcome Position vertritt und begründet. Brian Barry vertritt die These, das UBI sei unqualifiziert und genüge deshalb dem Anspruch der Gleichheit im Resultat nicht.
"We know better now, it is suggested, and should be concerned with an ‚equal outcome‘, which includes extra income for special needs and a system of compensation differentials for work"
Das Grundeinkommen könne weder die speziellen Bedürfnisse der von der Normalität Abweichenden decken, noch die Bedürfnissumme des Durchschnittsmenschen erreichen.
Krebs‘ und Michels Argument der Bedürfnisorientierung findet sich auch bei Richard Norman. Er möchte der genauen Bestimmung von praktikabler Bedürfnisbefriedigung entgehen und legt einzig Wert auf die Bestimmung und den Erhalt von Grundbedürfnissen. Während die präferenzorientierte Lösung der "equality of welfare" zu keiner gerechten Lösung kommen könne, sei die Bestimmung des Umfangs der gerechterweise zu befriedigenden Grundbedürfnisse vernünftigerweise einigungsfähig. Damit seien sie objektiv fundamentale menschliche Bedürfnisse. Alle Menschen seien als menschliche Wesen berechtigt, diese Grundbedürfnisse in einer Gemeinschaft befriedigt zu bekommen. Ein UBI könne nur dann gerechtfertigt sein, wenn es outcome-gerecht sei, d.h. mindestens die objektiven Grundbedürfnisse für alle decke. Norman hält es für wenig vielversprechend, die Garantie von wirklicher Freiheit (Einkommen, Macht, Grundfähigkeiten) nur durch ein Grundeinkommen zu gewährleisten. Wenn tatsächlich eine Gleichheit des Resultats geschaffen werden sollte, die über eine Chancengleichheit hinausgeht, dann müßte diese (unter Berücksichtigung individueller Ziele und Wege) die Grundbedürfnisse eines jeden befriedigen (diese sind zwar nach Norman eingrenzbar und gleich, nicht aber auf die gleiche Weise befriedigbar).
Würde nur eine Angleichung der Startbedingungen anvisiert (equal opportunity), seien auch diese nicht allein durch gleiche Mittel in Qualität und Quantität erreichbar.
5. Kompetitive Gleichgewichtspreise als Maßstab
Mit einer ganzen Reihe von Einwänden an van Parijs wartet Heiner Michel auf, die er unter dem Titel "Kritik am van Parijsschen Ökonomismus" zusammenfaßt. Nach Michel "überschätzt van Parijs die Fähigkeit ökonomischer Märkte, einem jeden zu einem Optimum an realer Freiheit zu verhelfen." Er behauptet, kompetitive Gleichgewichtspreise seien zwar ein naheliegender, aber kein geeigneter Maßstab, "die Gleichverteilung an realer Freiheit" zu messen.
Nach van Parijs hingegen ist das UBI (welches unbedingtes Mittel für alle ist) das optimale Mittel, um in einer Marktwirtschaft einen Mindestumfang an realer Freiheit umzusetzen, da Geld als allgemeines Äquivalent Zugang zu allen handelbaren Gütern bietet.
Der Favorisierung der Kraft des Geldes und der freien Märkte liegt Michel zufolge ein "Ökonomismus" zu Grunde, der ökonomische Kategorien zum Selbstzweck erhebe. Preise seien aber zwei Einwänden folgend (dem eudaimonistischen und dem ökonomischen) keine geeigneten Maßstäbe für wirkliche individuelle Freiheit.
a) Nach dem eudaimonistischen Einwand sei die reale Freiheit allein durch den Gebrauch bestimmt. Mittel zur Realisierung von Freiheit seien nicht selbst das Maß, sondern die tatsächliche Anwendbarkeit der Mittel in Einzelfällen. Ein bestimmtes Mittel könnte für die Eine ein hohes Maß an Freiheit möglich machen, für den anderen nicht. Abgesehen davon, daß dieser Einwand nicht neu ist, ist er auch gegen van Parijs hier wirkungslos. Wenn Mittel zur Realisierung nicht identisch sind mit dem Maß an individueller Freiheit, so ist das kein direkter Einwand gegen Preismaßstäbe, sondern eher einer gegen die Wirkung von Gleichverteilung. Wenn van Parijs ein UBI fordert, so bietet er jeder Person die Möglichkeit, sich die passenden Güter selbst zu besorgen, anstatt sie mit unbrauchbaren direkt auszustatten. Monetäre Mittel sind zwar nicht gleichzusetzen mit realer Freiheit, als allgemeines Äquivalent ist Geld aber immer noch ein brauchbares Mittel, um individuellen Präferenzen nachgehen zu können. Als krassen Beispiel gegen van Parijs nennt Michel den Schutz der Menschenwürde.
"Verletzung der Menschenwürde wie Freiheitsentzug, gesellschaftliche Ausgrenzung oder mangelnde medizinische Versorgung sind weder mit Preisgrößen bewertbar noch durch Geld kompensierbar."
Dem würde van Parijs gar nicht widersprechen. Sein UBI ist ja gerade ein Mittel, um genau diese gesellschaftlichen Grundgüter für alle erreichbar zu machen, und da, wo dies über das UBI allein nicht möglich ist, müssen die Grundgüter eben direkt vermittelt werden. Es gibt keinen Hinweise darauf, daß van Parijs eine andere Strategie verfolgt.
b) Der ökonomische Einwand ist etwas stärker. Er behandelt Eigenschaften und Abhängigkeiten von Preisen. Demnach sind Preise kontingent, politische Daten, reflektieren praktische Entscheidungen, reflektieren makroökonomische Entscheidungen und spiegeln Renditegewohnheiten wider. Sie sind laut Michel kein verläßlicher, gerechter Maßstab, um den Wert von Gütern auszudrücken.
"Die vielfältigen normativen und kontingenten Einflüsse sind sehr tief in die Produktionssituation verwoben und lassen sich nicht einfach in 'harte' technisch-ökonomische und normative Daten trennen."
Laut Michel bindet der Preismechanismus die individuellen Freiheiten aneinander. Damit würde die atomistische Sichtweise der individuellen Freiheitsgarantie ad absurdum geführt, da die Anwendung der Mittel zur Freiheitsgenerierung auf das Maß der Freiheit anderer unmittelbar Einfluß nehme. Dies ist zwar ein Problem, fraglich ist nur, ob es tatsächlich ein Gerechtigkeitsproblem ist, und wie alternative Maßstäbe aussehen könnten, die Michel nicht nennt.
Michel fehlt (wie allen anderen Autoren zuvor) nach der richtigen Einschätzung der Problematik von Ressourcengleichheit das gerechte Verfahren, individuelle Unterschiede besser zu berücksichtigen. So bleibt auch sein Verfahren zur gesellschaftlichen Verteilung per kollektiver Selbstbestimmung offen. Ebenso fehlen seine Maßstäbe dafür wann, "genug genug" sein soll, die ein Grundeinkommen nach oben begrenzten. Allein sollte van Parijs alles auf ein UBI setzen könnte die Privatisierung mit Maximierung des Grundeinkommens in Konflikt mit anderen kollektiven Werten gelangen.
Resümee zu Teil C
Die Aufarbeitung des Problems der Verteilungsgerechtigkeit in diesem Teil der Arbeit hat nicht nur gezeigt, daß es innerhalb einer Hauptströmung (der egalitären) kontroverse Ansätze und Lösungsversuche gibt, sondern auch, daß sich selbst durch die Auseinandersetzungen hindurch grundlegende Prinzipien zur Güterverteilung und zur Begründung einer sozialen Grundsicherung finden lassen.
Den Mitgliedern einer Gesellschaft Gerechtigkeit zukommen zu lassen, heißt, ihnen festgelegte Güter zu gewährleisten. Wird der Begriff der Güter weit gefaßt, so läßt sich darin alles zusammenfassen, was eine Gemeinschaft als relevante Werte benennt. Die Güter können natürlicher oder sozialer (gesellschaftlicher) Art sein, sie können extern oder intern sein, materiell oder immateriell, sie können Rechte und Fähigkeiten sowie Bargeld sein. Wie die Gemeinschaft ihren Mitgliedern die Güter gewährleistet, kann auf unterschiedliche Art geschehen. Das ist der zweite entscheidende Punkt neben dem Umfang der zur Debatte stehenden Güter. Die Gemeinschaft kann die Güter einem/r jeden aktiv entgegenbringen, sie kann aber auch dafür sorgen, daß alle bloß die Möglichkeit haben, sie sich selbst anzueignen. Sie kann alle gleichermaßen an der Generierung, an der Verteilung und an der Konsumption der Güter teilhaben lassen, oder die Teilhabe auf bestimmte Bereiche einschränken. Was Gerechtigkeit und soziale Grundsicherung betrifft, so läßt sich festhalten: soziale Grundsicherung im hier verwendeten Sinne besteht v.a. in der grundsätzlichen Ausstattung mit materiellen Gütern, und zwar im einfachsten Fall mit einem Mindesteinkommen. Alle hier behandelten Theorien würden eine solche Mindestausstattung befürworten. Nur wie sie genau zu verstehen ist, und wie sie umgesetzt wird, dort liegen markante Unterschiede.
Rawls behauptet, wir würden uns auf rationale Weise quasi a priori auf die Gewährleistung eines großen Umfangs an Grundgütern einigen. Die weitgehend vor aller Erfahrung festgelegten Gerechtigkeitsprinzipien sollen garantieren, daß niemand hinterher schlechter steht, als er im rein rationalen Zustand für sich mindestens wünschen würde. Neben der unbedingten Garantie gewisser Grundrechte und Grundfreiheiten, sozialer Anerkennung und politischer Teilhabe geht in das Grundrecht auf Wohlstand eine relative Komponente ein. Da das Differenzprinzip nicht individuell, sondern schichtspezifisch arbeitet, garantiert es ein Mindesteinkommen, welches nicht allzuweit vom gesellschaftlichen Durchschnitt entfernt ist. Rawls möchte dafür eine NIT einrichten, die diejenigen schützt, die ein Minimum an Kooperationswillen zeigen (Arbeitswille der Arbeitsfähigen). Wohlstand in Form eines Bürgergeldes zzgl. den Unterstützungen für niedrige Erwerbseinkommen besteht bei Rawls nur auf Grundlage der gegenseitigen Anerkennung der Leistung für den Erhalt der Gemeinschaft. Gegen diese Lösung gibt es zwei Haupteinwände:
1. Diese Regelung berücksichtigt die individuellen Unterschiede, die zunächst beachtet werden müßten, um tatsächliche Gleichheit für alle zu schaffen, nicht. Große Unterschiede zwischen den Menschen (z.B. genetische) müßten weitgehend kompensiert werden, um gleiche Ausgangsbedingungen herzustellen. Die Einkommensgleichheit ist also nur dann vollkommen, wenn alle relevanten (auch internen) Ressourcen addiert werden. "Equality of income" braucht somit eine ursprüngliche Ungleichverteilungskomponente der externen Ressourcen, wenn die Gleichverteilung der internen Ressourcen nicht möglich ist. Offen bleibt, wie zu handeln sei, falls die ungleichen internen Ressourcen nicht durch die externen Ressourcen wirklich kompensiert werden können. Dabei liegt eigentlich auf der Hand, warum der Vergleich und das Aufrechnen von internen und externen Ressourcen nicht so einfach möglich ist: während die internen Ressourcen verwoben sind mit den Subjekten der Gerechtigkeitskonzeption, sind die externen Ressourcen ihnen bloß äußerlich; sie sind reine Objekte der GK. Mit diesem Unterschied vor Augen ließe sich manche Scheindebatte überwinden.
Die zweite Möglichkeit wäre, so zu agieren, daß alle möglichst ‚gleich raus‘ sind ("equality of outcome"). Je nachdem, wie weit dabei individuell unterschiedliche Ausstattungen und Bedürfnisse berücksichtigt werden, spielt die quantitative Gleichverteilung eine geringe bis gar keine Rolle, um den Beteiligten die Mindestausstattung zu gewährleisten, die sie sich wünschen.
Für eine "equality of income" spricht sich Dworkin aus, indem er starke Benachteiligung abseits der Schichtzugehörigkeit berücksichtigt. Seine Lösung, die er anstatt der tatsächlichen Angleichung aller Einkommen und Vermögen ausarbeitet, ist aber auch nur ein Sozialversicherungsmodell mit Risikoabsicherung gegen starke Schicksalsschläge und einer NIT zur Armutsvermeidung.
Sen nimmt stärker Rücksicht auf die Umsetzbarkeit der zur Verfügung gestellten Ressourcen. Damit orientiert er sich an der Wirkung des Einkommens bezüglich des "outcomes". Auf die Gleichheit der Grundfähigkeiten einzugehen heißt nach Sen, nicht alle Präferenzen berücksichtigen zu wollen, sondern lediglich, allen die reale Chance auf Wohlbefinden und selbst gesetzte Ziele zu maximieren. Benachteiligung als Folge von Einkommensarmut lasse sich nicht allein durch monetäre Umverteilung aus der Welt schaffen. Sen fordert aktive Unterstützung der individuellen Benachteiligung, um Grundgüter wirklich (und nicht nur formal) für alle zu garantieren und alle daran weitgehend gleich profitieren zu lassen.
2. Der zweite Haupteinwand wird von van Parijs vorgetragen und betrifft die Bedingungen, an die die Gewährleistung der Grundgüter geknüpft sind. Seiner Argumentation folgend gelten Grundgüter für alle unbedingt, so auch ein Mindesteinkommen. Zugleich müßte allen gleichermaßen ein einfaches, geeignetes Mittel an die Hand gegeben werden, das die Grundlage ihrer Lebensvorstellung umsetzen hilft, um für alle reale Freiheit zu garantieren. Er fordert deshalb ein UBI als Leistung ex ante, einem pragmatischen Weg folgend, das apriorische Freiheitsideal für alle zu verwirklichen.
Offen bleibt, wie die Gerechtigkeit bei der Generierung der Güter in eine Gerechtigkeitstheorie implementiert werden könnte. Wäre die Aneignungsgerechtigkeit von der Verteilungsgerechtigkeit komplett getrennt, könnte es starke Verzerrungen in bezug auf die gesamtgesellschaftliche Situation geben. Wenn sich nicht alle Ausbeutungsverhältnisse offen legen und beseitigen lassen, so muß zumindest allen die wirksame Wahl gegeben werden, potentielle, oder individuell als solche empfundene, Ausbeutungsverhältnisse ohne Nachteil meiden zu können. Freiheit von Ausbeutungszwang und Produktionsdemokratie könnten durch gleichen und freien Zugang zu Produktionsmitteln oder Freiheit von gesellschaftlich etablierter Produktion durch ein Grundvermögen oder -einkommen für alle geschaffen werden.
Schließlich wurde in diesem Teil zu begründen versucht, warum ein UBI eine effektive Umsetzung von Verteilungsgerechtigkeit und eine gerechte soziale Grundsicherung ist. Trotzdem wird eingeräumt, daß das UBI vielleicht ein notwendiges, aber kein hinreichendes Mittel zur gerechten Güterverteilung ist.
Die Auseinandersetzungen um "equality or not" und "equality of welfare or resources" lassen sich auf die (lösbare) "income-outcome" Debatte reduzieren. Minimale Gerechtigkeitsprinzipien lassen sich sowohl für die "income" als auch zugleich für die "outcome" Perspektive entwickeln, die relativ stabil gegenüber den meisten gängigen Einwänden bleiben und zugleich nicht unbedingt einer strengen Richtung verpflichtet sein müssen. Zudem läßt sich auf Grundlage dieser Prinzipien ein Fahrplan für eine soziale Grundsicherung entwickeln.
Income- und Outcomegerechtigkeit
Einstiegsausstattung muß erfüllt sein
min.: UBI auf absolutem Input min.: Grundbedürfnisse (incl. Existenzminimum Ungleich- subj. Grundbedürfnisse; aktive
max.: UBI nahe Gleich- verteilung Unterstützung - Sen)
verteilung bzw. reines max.: alle Bedürfnisse,
Gemeineigentum max. Wohlbefinden für alle
gleich nahezu gleich (undominated diversity)
Diese Sichtweise erfüllt die Prinzipien der fast vollständigen Gleichbehandlung sowie der fast gleichen Lebensqualität. Zunächst wird nach dem egalitären Prinzip der Gleichbehandlung mindestens ein geringes UBI für alle ausgezahlt (max. Volkseinkommen u. Volksvermögen geteilt durch die Bevölkerung; bzw. reines Gemeineigentum). Insofern diese Maßnahme nicht die Liste der Rawlsschen Grundgüter für alle garantiert, werden diese Güter direkt allen (Input) zugeteilt, bzw. die Möglichkeit des freien Zugangs leximiert. Sollten dennoch individuelle Ungleichheiten bezüglich der Lebensqualität zu erwarten sein, werden nach Senschen Prinzipien die individuellen Benachteiligungen unter Rücksichtnahme auf kulturelle, subkulturelle, ethnische, schicht- oder klassenspezifische Unterschiede mindestens so angeglichen, daß die Grundbedürfnisse gleichermaßen befriedigt sind (max. alle Bedürfnisse / max. uneingeschränktes Wohlbefinden). Da sich aus der Auseinandersetzung mit den Gerechtigkeitstheorien keine Verfahren für die Umsetzung des Inputs ergeben haben, muß dieser Punkt notgedrungen offen bleiben.
Mit der Umsetzung dieser income-outcome Kombination im Bereich Einkommensarmut befaßt sich der abschließende Teil D.
B: Grundsicherungssysteme zur Bekämpfung von Einkommensarmut
C: Gerechtigkeit und soziale Grundsicherung
D: Vorschlag für ein gerechtes Reformmodell zur Vermeidung von Einkommensarmut